Von Patienten und Magneten
Immer noch Chaos auf der Station.
Heute darf ich meine Liste von Patienten verlängern und Neuzugänge
aufnehmen. Einer davon ist eigentlich nichts Kompliziertes. Eine
Infusionstherapie aufgrund einer Nervenkrankheit, die er schon zig mal gemacht
hat.
Aufnahmegespräch. Ich stelle die üblichen Fragen. Ob er die Therapie
das letzte Mal vertragen habe, ob er davon profitiert habe, wie lange, wann es
wieder schlechter geworden sei, was die jetzigen Beschwerden sind, ob er mit
der Medikation zu Hause zurecht kommt, was die Schmerzen machen.
Er beantwortet alles. „Und die Stimmung ist in letzter Zeit auch
wieder schlechter…“ „Schwere depressive Episode“, steht in den Vordiagnosen,
das hatte ich gelesen. „Sind Sie denn aktuell in Behandlung?“, frage ich. Er
sei wohl lange nicht mehr beim Psychiater gewesen, habe aber jetzt einen Termin
für den nächsten Monat gemacht. Na fein. Ich eruiere noch ein bisschen die aktuelle
Stimmungslage, klappere die Kardinalfragen einer depressiven Störung ab und
komme zum Schluss darauf, dass ihm wenigstens mal seine Enkel noch Freude
bereiten, aber es sonst recht düster in seinem Leben zu sein scheint. „Für Ihre
Stimmung werden wir hier leider nicht so viel tun können“, schließe ich, „da
ist der psychiatrische Kollege der richtige Ansprechpartner. Vielleicht hilft
aber eine Verbesserung des körperlichen Zustandes auch schon ein bisschen“,
postuliere ich. Und dann schließe ich mit der üblichen Frage in solchen
Situationen, ob wir uns jetzt akut Sorgen machen müssen. Nein, entgegnet er. Und
ich ermahne nochmals sich zu melden, wenn es schlimmer wird.
Damit ist das Thema für mich erstmal abgefrühstückt.
Am Nachmittag muss ich wieder in das Zimmer, um die erste Infusion
anzuhängen. Er hält mich nochmals auf. Kommt nochmals auf seine Stimmung zu
sprechen. Da hat aber Jemand Redebedarf, denke ich mir. „Ich habe einfach
Angst, dass mir irgendwann dasselbe passiert…“, erklärt er. „Dasselbe wie was…“,
hake ich nach. „Naja mein Vater und mein bester Kumpel sind durch einen Suizid
gestorben…“, sagt er. Jetzt lege ich doch das Klemmbrett auf die Seite. „Da
sind Sie aber auch vorbelastet…“, sage ich. Er redet weiter. „Bei meinem Vater…
- da war ich ja irgendwie noch jung und habe das gar nicht so richtig
verstanden, aber mein bester Kumpel... Wir haben uns wirklich prima verstanden,
er war ein lustiger Typ und dann… - von jetzt auf gleich…“ Ich nicke. Überlege
noch, was ich dazu sagen soll, aber er redet schon wieder weiter. „Und mir kann
da halt echt keiner helfen – ich habe schon drei Therapeuten durch und wenn ich
dann rede und erzähle, da können die irgendwann gar nichts mehr sagen. Und das…
- frustriert einfach nur…“
Ich ziehe mir einen Stuhl ran. „Ich bin kein Therapeut – ich kann
Ihnen da auch nicht so richtig helfen…“, erkläre ich. „Es belastet mich halt
ungemein. Dass diese Schuldfrage aufkommt, das können die Meisten noch
irgendwie nachvollziehen – auch wenn man immer hört, man sei nicht Schuld. Aber
da hängt einfach so viel mehr dahinter…“, unterbricht er schon wieder.
Ich überlege. „Wissen Sie“, leite ich ein, „ich weiß gar nicht, ob ich
Ihnen das jetzt überhaupt erzählen soll und wahrscheinlich sprengt das den
professionellen Rahmen ziemlich. Ich kann Sie verstehen. Mein bester Freund hat
sich vor ein paar Wochen das Leben genommen und ich hätte vorher niemals
gedacht, was das alles nach sich zieht. Die Schuldfrage ja, die stellt man
sich. Und sowohl Sie, als auch ich wissen auf einer rationalen Ebene, dass wir
nicht Schuld sind.“ Er nickt. „Aber…“, führe ich weiter aus, „auch ich habe
gemerkt, dass es das eigene Erleben, das Vertrauen in sich und andere Menschen
völlig erschüttert und man da sehr vergeblich um Verständnis ringt. Und ich
glaube man muss da auch sehr gut auswählen, wem man sich anvertraut ohne auf
die Weise wieder Beziehungen kaputt zu machen. Ich erzähle Ihnen das an der
Stelle nicht, weil ich irgendwelche Probleme mit Ihnen und für Sie lösen kann.
Dafür fehlt mir einfach die Kompetenz in dem Fachgebiet. Aber ich kann Sie auch
einer menschlichen Ebene nachvollziehen und auch die daraus resultierende Not.
Was ich mir jetzt dazu kürzlich überlegt habe ist: Haben Sie es schon mal mit Selbsthilfegruppen
oder Vereinen versucht, in denen Menschen zusammen kommen, die dieselbe Art von
Verlust erlebt haben? Ich weiß selbst noch nicht, ob das hilft – das ist meine
neue Idee zu dem Thema…“ Nein, habe er noch nicht, sagt er. „Vielleicht kann ja
Ihr Psychiater da auch etwas vermitteln, wenn Sie ihn fragen“, rege ich an. Er
wird ihn fragen, sagt er.
Am Ende bedankt er sich. Für die Zeit, das Gespräch, das Verständnis
und die Anregungen.
Und wahrscheinlich sind das die Momente, die am Ende des Tages zählen.
Ich brauche danach erstmal ein paar Minuten im Treppenhaus, um wieder
gedanklich bei der Arbeit anzukommen.
Meine eigene Situation ist immer noch nicht besser. Und dennoch trage
ich schon wieder Menschen, obwohl ich selbst keinen Plan habe. Und mindestens
genauso viel Angst habe wie er, daran zu sterben.
Später schneit sogar noch kurz ein Oberarzt vorbei. Und obwohl es neurologisch
gesehen wichtigere Fälle gibt, konfrontiere ich ihn sofort mit der depressiven
Verstimmung des Patienten. „Hast Du ihn nach Suizidgedanken gefragt?“, fragt
er. „Ja, mehrfach…“, entgegne ich. „Ich habe trotzdem Angst…“, schiebe ich
hinterher. Wir stellen die antidepressive Medikation noch etwas um. „Jetzt mach
Dir keine schlaflose Nacht deswegen“, ermahnt der Oberarzt und dann spüre ich
seine Hand auf meiner Schulter. „Ich weiß, dass er da gerade bei Dir einen
wunden Punkt getroffen hat, aber es ist okay…“
Manchmal glaube ich, ich habe so einen Magnet. Für solche Patienten.
Mondkind
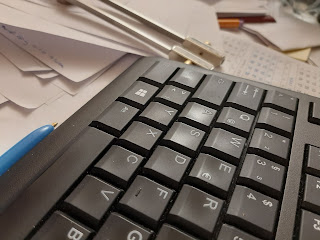



Kommentare
Kommentar veröffentlichen