Von einem Wochenende
Tell me everything now
Don't leave anything out
I'll tell you all my fears, my mistakes
Before it's too late
(Westlife – Before it’s too late)
***
Samstagmorgen.
So richtig gut habe ich nicht geschlafen. Allerdings gibt es an diesem Morgen noch einiges zu tun – unter anderem müssen noch zwei Maschinen Wäsche laufen, was insgesamt drei Stunden dauern wird. Deshalb beschließe ich, dass spätestens um 9 Uhr die erste Maschine angestellt werden muss und das wiederrum heißt, dass ich so sehr trödeln auch nicht darf.
Ich trinke einen Kaffee, mache die Waschmaschine an, mache den Haushalt fertig und laufe danach kurz in die Stadt, während die zweite Maschine läuft. Der Kardiochirurg braucht noch eine neue Tee-/Kaffeekanne und ich hatte gesagt, dass ich mich darum kümmere. Dann muss ich das auch machen. Unterwegs ruft der Kardiochirurg an. Er ist fertig mit seinem Dienst und geht heim. „Du kannst Dir schon mal überlegen, was wir dieses Wochenende machen wollen. Mach einfach klare Ansagen, ich mache dann schon mit. Meld Dich dann in einer Stunde wieder.“ Kurzfristig habe ich schon wieder den Impuls das Telefon an die Wand zu schleudern. Warum bin ich immer für alles zuständig?
Zu Hause mache ich einen Plan. Heute können wir am Nachmittag spazieren gehen, einen Kaffee in der Stadt trinken und am Abend kochen und sprechen und am Sonntag – ist es die Frage, wie früh wir aufstehen wollen. Es gibt noch Dinge auf der Agenda, die definitiv ein knackiger Tagesausflug sind, aber wir könnten auch hier in der Nähe bleiben und ins Moor fahren; das sollte wieder offen haben.
Etwas mehr als eine Stunde später – ich habe noch meine Dopplerbefunde fürs Facharztlogbuch gezählt und festgestellt, dass sie reichen – rufe ich ihn an, aber er geht nicht ans Telefon. Ich schreibe ihm ein whatsApp, aber auch da kommt keine Rückmeldung. Sicher ist er eingeschlafen.
Meine Kapazitäten sich großartig darüber aufzuregen, sind erschöpft. Wir kennen das ja mittlerweile. Irgendwann zwei Stunden später meldet er sich, aber selbst sich zu verabreden sich in der Stadt zu treffen, ist heute irgendwie ein Akt von mehreren Stunden. Das Café hat halt auch nur bis 18 Uhr offen. „Ich mache gerade noch Pizzateig, habe aber schon Schuhe an“, schreibt er um kurz nach 17 Uhr. Schön… - das reißt es jetzt raus, dass er „schon Schuhe“ an hat.
Kurz vor halb sechs ist er hier und ein gemütliches Café – Date wird es nicht mehr. Ich vermute, die Zeit der Café – Dates ist wirklich vorbei. So etwas wie mit dem verstorbenen Freund wird es nie wieder geben. Wir beide haben auch nicht die Kapazitäten irgendwo Stunden herum zu sitzen und zu reden.
Wir schlappen noch eine Runde um die Burgmauer. Er ist angespannt und ziemlich genervt heute. Was immer schwierig ist, weil ich da nicht dazwischen komme. „Ich muss noch einkaufen und eine Menge aufräumen“, erklärt er. Und eine knappe Stunde nachdem er gekommen ist, bin ich schon wieder alleine. „Wie schaut es denn aus bei Dir?“, fragt er um kurz vor Neun. Ich habe unterdessen noch etwas Neuro wiederholt. „Naja ich warte, bis Du fertig bist“, antworte ich. So gegen halb 10 bin ich am Ende bei ihm, sitze auf einem Stuhl und warte, bis er die Wohnung fertig aufgeräumt hat. Danach machen wir Pizza. Er hat schon ein echt gutes Rezept für den Teig, das muss ich zugeben. Die Pizza schmeckt ziemlich gut.
Zeit für irgendeine Form von Abendbeschäftigung hat es nicht mehr. Wir machen uns bettfertig und liegen kurz vor Mitternacht erschöpft im Bett.
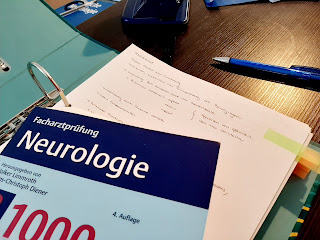 |
| Neurounterlagen sortieren. Wild, wie viel sich da in zwei Monaten Lernen angesammelt hat... Und wer soll das wann alles lernen...? |
Sonntag.
Ich bin schon kurz nach sechs Uhr wach. Zwischendurch döse ich immer mal wieder ein, träume allerhand Mist und habe das Bedürfnis mich an den Kardiochirurgen zu schmiegen, aber ich will ihn nicht wecken und lasse ihn auf seiner Seite ruhig weiter schlafen.
Um kurz vor neun Uhr schaut er mich an. Ich habe mich gerade zwei Minuten an ihn dran gekuschelt – wenn überhaupt – als er aufsteht. Ich dachte, er geht nur kurz zur Toilette und kommt dann wieder, aber als er den Wasserkocher einschaltet ist mir klar, dass er aufstehen möchte. Der Tag gestern war schon unproduktiv genug, befindet er. Naja, dafür kann ich aber nichts.
Wir frühstücken, hüpfen unter die Dusche und fahren los in Richtung Moor. Auf halber Strecke geht plötzlich eine Alarmlampe im Auto an. „Soll ich im Handbuch nachschauen, was los sein könnte?“, frage ich. „Nein“, entgegnet er. „Dein Auto ist schon eine kleine Diva“, sage ich. „Danke, ich weiß es“, entgegnet er in einem Tonfall, der signalisiert, dass ich lieber ruhig sein sollte. Es stellt sich heraus, dass das Auto gerade nicht mehr schneller als 100 km/h fahren kann. „Wir drehen um und nehmen Deins“, sagt er.
Unser Moorspaziergang ist still heute. Und es ist nicht so, dass ich nicht von Zeit zu Zeit Stille aushalten könnte, aber es ist eine unangenehme Stille. Es sind unglaublich viele Menschen heute da, die alle zu viel sind. Und vor allen Dingen zu viele aufgeweckte Kinder.
Die Weite der Landschaft hilft manchmal ein bisschen. Es fühlt sich an, wie Konfetti im Kopf. Als hätte man alles ein Mal in die Luft geworfen und als würde das nun langsam wieder in Richtung Boden segeln und dort liegen bleiben. Als hätte eine Party stattgefunden, an der man selbst nicht teilgenommen hat und nun herausfinden soll, was da eigentlich los war. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass ich kaum noch Resonanz in mir spüre. Altbekanntes Phänomen. Wenn alles zu viel ist, ist da irgendwann gar nichts mehr, außer einer diffusen Schwere.
Ich denk über uns beide nach. Den Kardiochirurgen und mich. Ich wüsste zu gerne, wie er das sieht mit uns. „Es wird nie wieder diese Leichtigkeit sein“, schießt mir dieser oft gehörte Kommentar in den Kopf und manchmal muss ich mich bemühen, dass keine Tränen in meinen Augenwinkeln landen. Manchmal vermisse ich die Mondkind von damals. Ich kann mich an diese Tage am Fluss in der Studienstadt erinnern. Wir haben das nicht hinterfragt. Wir haben uns nicht hinterfragt. Wir haben nie geglaubt, dass einer von uns gehen könnte. Auf welche Art auch immer. Heute ist das irgendwie anders. Und vielleicht beruht das nicht mal auf realen Tatsachen. Vielleicht ist das einfach die Angst um mein Herz. Die immer wieder dadurch befeuert wird, dass ja auch so Vieles ungeklärt ist.
Im April haben wir Urlaub und ich weiß nicht, was wir machen werden. Ob wir überhaupt etwas Sinnvolles zusammen tun werden. Allmählich müssten wir uns das mal überlegen. Vielleicht würde ich ansonsten einfach die Studienstadt besuchen. Eigentlich hat das langsam auch gar nicht mehr so viel Sinn, aber es schafft einen eigenartigen Frieden, diesem Leben von Damals nochmal nachzuspüren.
Was man auch spürt, ist der Frühling. Ich bin jedes Jahr aufs Neue erschrocken, wie viel das immer noch auslöst. Ich denke jedes Jahr, es wird besser, weil es eine ganze Jahreszeit ist. Kein Moment, sondern ein ständiges, diffuses Gefühl, das schlimmer bei jedem Schub von Frühling ist. Und ich glaube, es geht mittlerweile so viel weniger darum, dass ich glaube definitiv ein glücklicherer Mensch zu sein, wäre der verstorbene Freund noch an meiner Seite. Es geht um dieses Schuldding. Dass man sich jetzt wochenlang dabei zuschauen kann, wie man damals in etwas rein gelaufen ist, das am Ende nicht mehr zu kontrollieren war. Vor vier Jahren um diese Zeit wusste ich, dass wir ein Problem hatten, aber ich hatte keine Ahnung, wo das enden würde. Hätte mir jemand gesagt, dass er vier Monate später tot ist, hätte ich das nicht geglaubt.
Ich denke über den Job nach. Die letzten Tage habe ich ein bisschen quer gelesen. Ich bin ehrlich; ich vermisse manchmal die Neuro – Dienste. Nicht die Zeiten mit drei Diensten in einer Woche, nicht Erschöpfung und Übelkeit am nächsten Tag – obwohl all das wahrscheinlich dazu gehört. Aber ich vermisse es drei Notfälle gleichzeitig zu haben, aber mit dem Wissen, dass ich mittlerweile kompetent genug bin, alles im Griff zu haben. Das Rennen über die ZNA, die Kollegen der ZNA, mit denen ich wirklich gut zurecht kam, das Adrenalin, das einem ab und an das Gefühl vermittelt hat zumindest irgendetwas zu tun und noch zu leben. Wahrscheinlich werde ich diesen letzten Absatz in einem halben Jahr sehr bescheuert finden – bis dahin werde ich auch leider aus der Übung sein.
Manchmal frage ich mich, ob dieses Psychosomatik – Idee die Richtige ist. Und gerade, wenn ich selbst so viel im Kopf habe, ist das eigentlich kaum machbar, obwohl man nicht mal wirklich von „viel Arbeit“ sprechen kann.
Wir sind mittlerweile durch das Moor spaziert und noch ein bisschen einen anderen Wanderweg entlang. Auf dem Weg nach Hause fallen mir fast die Augen zu vor Erschöpfung. Wir halten beim Bäcker und nehmen noch etwas Kuchen mit.
Es ist immer noch still zwischen uns, aber ich wüsste nicht, was ich Sinnvolles sagen könnte. Und wenn ich nicht rede, sagt er auch nicht viel. Später liegen wir noch ein bisschen auf dem Sofa. Nicht so Körper an Körper, wie ich das jetzt brauchen würde, aber immerhin spüre ich ihn mal. „Wir wollten ja eigentlich noch sprechen dieses Wochenende“, werfe ich ein. „Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht“, ergänze ich. Und ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht finde er ja alles voll entspannt mit dieser Beziehung. Kann ja sein. Und ich für mich weiß auch nicht mehr, woher all die wahrgenommenen Schwierigkeiten kommen. Ich meine ja, es ist allein immer schwierig für mich, wenn Jemand so wenig spricht. Aber es ist eben schon die Frage, ob das alles etwas mit uns beiden zu tun hat, oder ob das von den Dingen kommt, die eben gewesen sind. Folglich ist die Frage: Habe ich etwas zu lösen oder haben wir beide etwas zu lösen? Vielleicht hat er damit gar nichts zu tun.
Ich hab manchmal schon Angst. Dass da irgendetwas unwiederbringlich verloren gegangen ist. Dass Beziehung nie wieder Vertrauen, Fallenlassen, sich sicher fühlen und all solche Dinge sind. Dass Du immer wieder mit Argusaugen auf den Anderen schauen musst. Wo ist der gerade? Geht der mit? Bringt er sich in Gefahr? Wie bewertet er die Beziehung?
Aber da er ohnehin nichts dazu sagt und ich jetzt nicht schon wieder Lust habe, ihn zu bedrängen…
„Ich hätte nicht von Ihnen erwartet, dass Sie das alles so gut machen werden“, sagte der Herr Psychiater am Ende unseres gemeinsamen Weges. Manchmal denke ich vielleicht heißt „gut machen“, dass ich wirklich viel geschafft habe, aber Einiges eben auch (noch) nicht.
Er muss noch die Wohnung aufräumen, beschließt er. Für mich ist es das Signal, meine Sachen zu packen.
Ich frag mich manchmal, ob es das nochmal geben wird. Dass wir uns von Freitagabend bis Sonntagabend ganz haben. Dass ich nicht immer gefühlt halb auf dem Sprung bin und nicht weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich fand das damals schon immer wenig. Hab schon damals darauf gewartet, dass ein gemeinsames „nach Hause kommen“, mal irgendwann Alltag wird. Ein Monat länger und wir hätten es geschafft. Manchmal glaube ich, das spielt auch eine Rolle. Ich hatte es nicht super eilig damals, aber natürlich war es das Ziel zusammen leben zu dürfen. Ein verdammter Monat. Auf all die fünf Jahre gesehen, ist das gar nichts. Als würde man Dir kurz vor dem Ziel, einfach das Zielschild wegnehmen. Und manchmal ist es schwer, das nicht als Strafe zu interpretieren. Als ein „vielleicht sollst Du das nicht erleben dürfen.“
Gerade, als ich heute Morgen mit meinen Kopfhörern auf seinem Stuhl saß, ein Westlifekonzert gehört habe und hoch zur Klinik geschaut habe, ist mir bewusst geworden, dass wir halt alle älter werden. Und das Leben eher ernster wird. Und so ein Medizinerleben eben so generell seinen Tribut fordert. Da ist eben mehr erstmal nicht drin. Das ist einfach so.
Wir stehen schon fast auf der Türschwelle. Er nimmt mich nochmal in den Arm. Und am liebsten würde ich ihn gar nicht mehr loslassen. Es fällt mir gerade so schwer, ihn zu spüren. Mit all dem Chaos, das in mir ist; da kommt wenig durch. Da muss er mich schon sehr fest in den Arm nehmen.
„Bis vielleicht morgen“, sagt er. Es ist alles ein vielleicht. Immer. Und gerade bräuchte ich ihn eigentlich noch ein bisschen neben mir.
Mondkind



Kommentare
Kommentar veröffentlichen