Resümee der Klinikzeit
Klinikrückblick.
Wo fängt man eigentlich an?
Wenn ich wieder im Wohnzimmer an meinem Tisch sitze, dann kommt es mir
so vor, als sei ich nie weg gewesen. Obwohl ich vor Weihnachten zuletzt in
dieser Wohnung saß. Und dennoch verschwindet die Klinikzeit in einer Art Nebel
und Zwischenwelt und es ist, als würde die Zeit zusammen schmelzen. Habe ich
das alles wirklich erlebt? War ich wirklich da?
Ich glaube – um die Zusammenfassung für die eiligen Leser mal vorweg
zu schieben – es ist eine gute Klinik und es ist auch nicht so, dass ich nichts
erreicht hätte. Und dennoch ist es so eine Sache, wenn man wartet, bis absolut
gar nichts mehr geht. Das Konzept einer Psychosomatik ist ja auch nicht die
Therapie von akuten Krisen. Hätte meine Therapeutin keinen Draht in die Klinik
gehabt, hätte ich so schnell gar keinen Platz bekommen und vermutlich hätte es
– wenn ich es hätte überleben wollen – zwangsläufig in der Psychiatrie geendet.
Und obwohl meine Einzeltherapeuten und ich den Rahmen weit jenseits
dessen ausgedehnt haben, was eigentlich an Betreuung vorgesehen war, war das
häufig nur ein Durchhalten und überleben; ein Hangeln von Termin zu Termin.
Was mich jetzt vor die Frage stellt: Wie geht es weiter? Ich weiß es
nicht. Ich habe keine Ahnung.
Es ging eigentlich schon mit dem letzten Dienst los, den ich gemacht
habe. Das Ende eines Dienstmarathons, drei Dienste in sechs Tagen. Und als ich
danach das Krankenhaus verlassen habe, wusste ich: Die Chancen stehen jetzt
ziemlich gut, es zumindest bis zur Klinik zu überleben.
Kurz vor Weihnachten. Meine Schwester war noch da gewesen und hier für
sie da zu sein und etwas mit ihr zu unternehmen, lag auch eigentlich weit
jenseits dessen, was ich noch leisten konnte. Und obwohl meine Schwester eher
so ein „spring – ins – Feld“ ist und viel unternehmen wollte, konnten wir nur
wenig machen.
Nachdem sie wieder gefahren war, musste ich die Klinik vorbereiten.
Die Wohnung startklar machen, den Schlüssel den Nachbarn übergeben, alle
offenen Rechnungen noch überweisen, in der Neuro die restlichen Briefe fertig
schreiben und die EEGs auswerten. Kurz vor Weihnachten ein Ortswechsel in
unbekannte Gefilde hat mir viel Angst gemacht. Mir war klar, dass man da
wahrscheinlich viel abfangen muss und mich da auf eine Institution zu
verlassen, die ich noch nicht kannte, fiel mir schwer. Überhaupt – nach den
letzten Psychiatrie – Erfahrungen wieder in ein stationäres System vertrauen zu
müssen, war eigentlich nichts, was ich wirklich wollte. Was, wenn man mich
nochmal so überfahren würde, nicht ernst nehmen würde?
21. Dezember. Aufnahmetag. Der Wecker hat schon sehr früh geklingelt,
ich habe es kaum geschafft aufzustehen. Mit letzter Kraft habe ich noch
versucht ein bisschen Ordnung in der Wohnung zu machen, die ich nun den
Nachbarn überlassen würde. Da musste es ja schon einigermaßen vernünftig
aussehen. Es war ein sehr kalter Tag, aber geschneit hatte es nicht. Das ganze
Gepäck zum Bahnhof zu schleppen war eine Herausforderung für sich und dort habe
ich ausgerechnet noch einen Kollegen aus der inneren Medizin getroffen, für den
ich mir schnell eine Ausrede einfallen lassen musste, wo genau ich eigentlich
hin wollte. Allerdings konnte er mir mit dem Gepäck zumindest bis zum Umsteigen
helfen. Auf dem Bahnhof dort habe ich gezittert wie Espenlaub. Ob vor Kälte
oder vor Aufregung – ich weiß es nicht.
Kurz nach 10 Uhr habe ich das Gepäck die Einfahrt zur Klinik hinauf
geschleppt. Dort wurden die Neuankömmlinge erstmal in einem Zelt geparkt, in
den man netterweise einen Heizpilz gestellt hatte. Ohne Corona – Schnelltest
ging hier gar nichts, aber während wir noch auf die PCR – Ergebnisse warten
würden, durften wir uns zumindest frei im Haus bewegen. Gewagtes Konzept, aber
24 Stunden Isolation hätte ich kaum überstanden.
Nachdem ich zumindest schon mal von der Pflege und dem
Patientenmanagement im System aufgenommen wurde, hat die Pflege mich erstmal zu
meinem Zimmer für die nächsten Wochen gebracht. Und dann der erste Schock:
Doppelzimmer. Und das in meinem Zustand, wo ich doch einfach nur meine Ruhe haben
wollte. Und dort brach es dann erstmal über mich hinein und es liefen die
ersten Tränen des Tages.
Zum Mittag konnte ich eigentlich nichts essen und kurz danach hat mich
schon mein damaliger Bezugstherapeut abgeholt. Sein Zimmer war bei uns um die
Ecke, wir mussten nur ein Mal die Treppen hoch laufen und über den Flur, unter
dem immer der Boden geknarrt hat, wenn man drüber gelaufen ist. Und dann saßen
wir in einem kleinen Büro ganz am Ende des Geländes unter der Dachschräge. Die
erste Frage war, wie es mir geht und auf meine Antwort hin, dass ich sehr
überfordert sei, merkte er an, dass ich ja schon mehrfach in Kliniken gewesen
sei und das Aufnahmeprocedere ja überall gleich sei und er das somit nicht ganz
nachvollziehen könne. „Was für ein Vogel“, dachte ich mir nur. Und ob mein
Unterbewusstsein dennoch bereits eine Sympathie hergestellt hatte, oder ob ich
so am Ende meine Kräfte war – ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich in meiner
Erzählung warum ich überhaupt da bin bemerkt, dass ich am Besten ganz weit
vorne anfange, damit ich Zeit habe, mich zu sammeln. Und während ich in meiner
Geschichte mit meinem Freund noch irgendwo bei 2018 war, grätschte der
Therapeut dazwischen: "Aber Ihr Freund von dem Sie gerade erzählen lebt nicht
mehr, oder?“ Und dann war es vorbei. Mir ist das noch nie passiert, dass ich im
Erstgespräch angefangen habe zu weinen und mich gar nicht mehr beruhigen
konnte. „Das passiert mir normalerweise nicht; ich bin sonst nicht so“, habe
ich gesagt. Ich glaube aber, ihn hat es gar nicht so gestört. Kennen sie
vielleicht dort.
Die Ärztin hat mich – nachdem der Therapeut und ich überzogen hatten
und er dort angerufen hatte und meine Verspätung angekündigt hatte – mit den
Worten „Ihr Therapeut hat mich vor sieben Minuten angerufen“ begrüßt und dann
liefen die nächsten Tränen. Was zum Geier wollten die denn von mir? Ich war
froh, dass ich noch stehen konnte. Das hat die Ärztin dann allerdings auch
bemerkt und mich für den Rest des Tages ins Bett gesteckt. Alle anderen
Aufnahmeuntersuchungen und Gespräche würden am Tag darauf stattfinden.
Nur die Hausführung von meiner Patin aus der Kerngruppe hatte ich
abends noch. Was ich damals noch nicht wusste war, dass sie alle Regeln noch
etwas strenger ausgelegt hat, als das Haus. Die achten sehr auf das Einhalten von Regeln,
das stimmt schon, aber wofür man alles eine gelbe Karte kriegen könnte – das
konnte ich mir nicht mal merken. Abgesehen davon hat mein Terminplan für den
nächsten Tag bis 10 Uhr vier Termine vorgesehen. Ich wusste nicht, wie ich das
schaffen sollte. Und irgendwie ist mir langsam klar geworden, dass mein Zustand
eigentlich viel zu schlecht für eine Psychosomatik ist.
Es war eine unruhige erste Nacht.
Am nächsten Morgen musste ich schon um kurz nach sieben bei der
leitenden Psychologin antanzen für ein 10 – minütiges Aufnahmegespräch. Und
dort konnte ich auch nichts anderes tun, als weinen. „Es ist gut, dass Sie hier
sind. Und auch, dass Sie vor Weihnachten noch gekommen sind“, waren damals ihre
Worte. Eigentlich kann die Dame sehr ruppig sein, wie mir vorher gesagt wurde.
Aber davon hatte ich bei diesem Gespräch nichts gemerkt. Ich war in dem Moment
einfach nur dankbar, sicher sein zu können.
In der Therapieplanbesprechung saß ich an diesem Tag wieder meinem
Bezugstherapeuten gegenüber. Wir haben darüber geredet, wie ich meinen Eltern
über Weihnachten erklären soll, wo ich eigentlich bin – die wussten nämlich von
nichts. „Sie können mir auch deren Nummer geben, dann kläre ich das mit denen.“
Dasselbe hatte er mir auch für meinen Arbeitgeber angeboten. Ich habe beschlossen,
dass ich es selbst versuche, aber sonst dankbar auf ihn zurückkomme. Und
gleichzeitig – das habe ich bei der Mitpatientin bemerkt – hat er eine eindeutige Entscheidung für die Therapie erwartet, ansonsten durfte man gehen. Und
irgendwie fand ich das sehr sympathisch. Diese Strenge, die ich auch oft
brauche. Und gleichzeitig eine bedingungslose Unterstützung wenn man sich auf
den Weg in die Therapie macht.
Ich musste dann erstmal allerhand Fragebögen ausfüllen und weil ich so
überfordert mit allem war, hat Herr Therapeut mir für die ersten vier Tage für
jeden Tag einen Bogen mitgegeben und genau aufgeschrieben an welchem Tag der wo
abzugeben war.
In der ersten Kerngruppe noch vor Weihnachten habe ich schon bemerkt, dass das schwierig werden würde, dort meinen Platz zu finden. Zunächst stand der Freund im Mittelpunkt und dann kam ganz lange nichts. Ich konnte nichts anfangen mit Menschen, die sich darüber aufgeregt haben, dass der Partner die Spülmaschine nicht ausräumt. Ich wäre doch so froh, wenn ich jemanden hätte, über den ich mich aufregen könnte, weil er nicht im Haushalt hilft.
Weihnachten. Unsere Cotherapeutin hat erklärt, dass sie gern über
Weihnachten arbeitet. Jeder von uns habe einen Grund über Weihnachten in der
Klinik zu sein und das möchte sie gern würdigen und für uns da sein. Wow, das
war mal ein Statement. Über Weihnachten hatte es ein bisschen geschneit und so
haben wir einfach einen Weihnachtsspaziergang durch die verschneite Landschaft
gemacht. Ich konnte ein bisschen die Menschen in meiner Kerngruppe kennen
lernen und meiner Cotherapeutin zuhören, die über ihre Familie berichtete, was
mich irgendwie sehr bewegt hat. Zu hören, wie Weihnachten woanders gefeiert
wird und wie es sein kann.
Und natürlich ließ auch die Weihnachtskrise nicht lange auf sich
warten. Aber die Cotherapeutin hat wachsame Antennen dafür gehabt und so kam
es, dass ich kurz in ihrem Büro sitzen durfte ohne dass ich überhaupt danach
fragen musste. Und allein das hat viel Ruhe ausgelöst. Gesehen werden, getragen
werden, nicht alleine sein über diese schwierigen Tage des Jahres.
 |
| Einer dieser ganz, ganz wertvollen Zettel |
 |
| Weihnachtsschmuck im Kurpark |
Nach Weihnachten haben die Cotherapeutin und Herr Therapeut getauscht
und mein damaliger Therapeut hat die Gruppe und Verantwortlichkeit für uns
wieder übernommen. Es war noch meine erste Woche, in der ich den ersten Text zu
seinem Briefkasten getragen habe. Ich fand dieses System mit den Briefkästen
bei jedem Therapeuten sehr nützlich; es kam mir mit meiner Schreiberei sehr
entgegen und es hat auch dafür gesorgt, dass ich die Grenzen des Systems ein
bisschen schieben konnte. Wenn ich mich mitteilen musste, konnte ich das tun.
Dass allerdings alles in der Kerngruppe landet, habe ich dann auch
schnell mitbekommen: „Frau Mondkind, ich habe da einen Zettel von Ihnen in
meinem Briefkasten gefunden – sollen wir darüber heute noch reden?“ Es war mir
unangenehm vor der ganzen Gruppe einen Sondertermin bei Herrn Therapeuten zu
bekommen, aber ja – wir mussten darüber reden.
„Ich habe mal gehört, man muss die Geschichte so oft im Kreis erzählt
haben, bis man subjektiv das Gefühl hat, ein Mal gehört worden zu sein“, habe
ich Herrn Therapeuten erklärt und er hat dem sogar eine gewisse Verarbeitung
der Geschehnisse zugeschrieben. Also ging es bei ihm schon in der ersten Woche
in den späten Abendstunden um Verlust, Schuldfrage und freien Willen. Und schon
da kamen immer mal hilfreiche Anstöße. So zum Beispiel, dass es so viele „was –
wäre – wenns“ gibt, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, die zu
hinterfragen.Und er hat es mir - das fand ich so bemerkenswert - überhaupt nicht übel genommen. Irgendwann habe ich mal gesagt, dass ich wirklich ein schlechtes Gewissen habe, ihn so zu beanspruchen, aber dass es mir gut tut und es danach ein bisschen leichter in mir ist. "Und in mir ist es gar kein Bisschen schwerer", hat er geantwortet. Dieser Mensch war wirklich Gold wert.
Jahreswechsel. Den haben wir dann mit meinem alten Therapeuten
verbracht. Wir haben uns abends um 22 Uhr getroffen, sollten aufschreiben, was
wir vom letzten Jahr alles gern loslassen würden und haben diese Zettel dann im
Park neben dem Fluss verbrannt. Pünktlich um Mitternacht waren wir dann wieder
zurück und standen oberhalb der Klinik, um uns ein besseres neues Jahr zu
wünschen und ein paar Raketen beim Weg in den Himmel zuzuschauen.
Es war ein wunderschöner Jahreswechsel – auch wenn ich etwas gestresst
war, weil die Kollegen Stress mit ihrem Dienstplan hatten und meinten mich am
Silvesterabend um 21 Uhr damit behelligen zu müssen, aber wir konnten das in
der Gruppe mit dem Therapeuten sofort klären. Und irgendwie hat es den
Vertrauensaufbau zu dem Herrn Therapeuten noch ein bisschen beschleunigt, da
wir eine so spezielle Zeit des Jahres mit ihm verbracht haben.
Beginn des neuen Jahres.
Ich hatte ein bisschen Vertrauen in dieses stationäre System gefasst
und damit begann des Fallen. So schnell und so sehr, dass ich gar nicht mehr
wusste, wohin eigentlich mit mir. Nachdem als Therapieziel „Reflexion
emotionaler Prozesse im Zusammenhang mit dem Suizid des Freundes“ auf meinem
Therapieziele – Zettel stand, wurde mir nochmal brutal klar, dass da etwas
passiert war, dass ich bisher scheinbar nicht oder zumindest nicht ausreichend
reflektiert hatte. Mir wurde irgendwann klar, dass mein soziales System im
Prinzip im Inbegriff eines kompletten Resets ist, ohne dass ich es da aktiv
hingeführt habe. Ich habe einfach viele soziale Kontakte verloren nach dem Tod
meines Freundes und hatte auch selbst keine Kraft mehr diejenigen, die
vielleicht geblieben wären, bei der Stange zu halten.
Ich hatte mir vorgenommen, mir diesmal eher und gezielter Hilfe zu
holen, aber scheinbar hatte ich doch so lange gewartet, bis ich ziemlich
angeschlagen vor der Pflege saß und deshalb endete das dann an einem
Samstagabend mit der Dienstärztin, die mir dann erstmal erklärte, wer aus ihrer
Familie schon alles gestorben war und wie schwer sie es gehabt hat. Irgendwie
hat mich die Pflege mit regelmäßigen Kontakten dann über das Wochenende gezogen
und dann begann die neue Woche.
Es war das Ende der zweiten und die dritte Woche, in der mir die
Situation um die Ohren geflogen ist. Die leitende Psychologin kannte ich
eigentlich nicht, deshalb hatte ich am Montagmorgen nach diesem Wochenende
nicht das Bedürfnis mit ihr das Wochenende zu besprechen. Am Nachmittag im
Einzel kamen die Themen dann aber doch auf den Tisch und auch, dass es da viel
um das Thema Suizidalität gegangen war. Aus einem „gewissen Ärgernis“, das dadurch
bei der leitenden Psychologin entstanden war, musste ich erstmal beweisen, dass
ich keine Borderline – Störung habe und das Klinikpersonal systematisch
manipuliere, aber das haben wir dann mittels Fragebogendiagnostik (der
Fragebogen funktionierte ungefähr wie das IMPP und ich habe mich in alte Zeiten
zurück versetzt gefühlt) geklärt.
Es war dann auch klar, dass der alte Therapeut uns nicht bis zum Ende
meiner Klinikzeit erhalten bleiben wird, sondern nach dreieinhalb Wochen meiner
Klinikzeit die Gruppe an einen neuen Therapeuten abgibt.
Die zweite und dritte Woche ging es viel um Suizidalität. „Ich habe
Sie Ihnen angesehen, diese Lebensmüdigkeit“, waren die Worte des alten
Therapeuten, der mich wohl morgens schon durch Haus hatte tapsen sehen.
Es war schön, dass dieses Thema einfach da sein durfte. Dass er es –
natürlich dann doch mit Unterstützung der leitenden Psychologin – mitgetragen hat.
Es war gut zu hören, dass es keinen Sinn macht, dieses Thema in sich
einzusperren, wenn es eben da ist. Weil es dann nur noch mehr Druck mache und
das dann wirklich unkonrollierbar sei. Dass ich in seinem Büro darüber reden
konnte, dass er vor meinem Hintergrund als nachvollziehbar aufgefasst hat, hat
gefühlt Tonnen von Last von meinen Schultern genommen.
Irgendwann in dieser Zeit muss ich auch mit viel Unterstützung des
Herrn Therapeuten meine Geschichte mit meinem Freund in der Gruppe erzählt
haben. Ich habe relativ wenige Erinnerungen an diese anderthalb Wochen. Ich weiß
nur, dass ich ständig über den knarrenden Boden auf dem Flur vor Herrn
Therapeutens Büro gelaufen bin, mehr als ein Mal das Abendessen verpasst habe,
weil wir dort oben gesessen und geredet haben. Während einer dieser Gespräche
ist irgendwann dieser unglaublich wertvolle Satz entstanden, dass die Antwort
auf die Starre im Herzen die Liebe sein kann.
Und trotz eines wahnsinnig hohen Betreuungsaufwandes war es schwierig.
Am Freitag, bevor der damalige Therapeut unsere Gruppe abgegeben hat, saß ich
noch nachmittags mit der leitenden Psychologin und dem Therapeuten im Büro und
wir haben über eine Verlegung in die Psychiatrie gesprochen. Ich hatte
Herzrasen ohne Ende und irgendwie haben wir es doch geschafft, dass ich dort
bleiben durfte.
Die Woche danach war schwierig. Therapeutenwechsel. Und der neue
Therapeut und ich… - ich weiß nicht, was da los war. Er hat mich mit „Sie
müssen Entscheidungen treffen“ und „eigentlich interessiert uns die
Vergangenheit gar nicht so sehr, interessant sind nur maximal die Zukunft und
vor allen Dingen die Gegenwart“, überfahren. Da hat er zwar grundsätzlich nicht
Unrecht und doch sitzen wir alle in der Klinik, weil in der Vergangenheit etwas
passiert ist, das so schlimm war, dass wir damit in der Gegenwart nicht leben
können.
Von insgesamt fünf oder sechs Stunden Betreuung auf 20 Minuten in der
Woche danach – das war schon hart. Mit dem alten Therapeuten konnte ich im
Einzel immer gut besprechen, wie ich mein Thema in die Gruppe bringen konnte –
das war mit dem neuen Therapeuten so nicht mehr möglich.
Der Therapieprozess geriet ziemlich ins Stocken; ich habe versucht mir
über das Briefkastensystem der Klinik Gehör zu verschaffen. Und irgendwann ist
mir dann auch aufgefallen, dass ich mich jetzt lange fast ausschließlich mit
meinem Freund beschäftigt habe und dahinter einen Menschen vergessen habe
anzuschauen: Mich selbst. Mir ging es ja schon vor seinem Tod nicht gut. Und so
kam es dann, dass ich fast zwei Wochen nach dem Therapeutenwechsel bei der
Cotherapeutin im Büro saß und mit ihr über meine Arbeitssituation gesprochen
habe. „Dann haben wir hier also eine Patt – Situation“, war ihr Kommentar,
nachdem ich ausgeführt hatte, dass ich meine eigene Existenzberechtigung in
Frage stelle, wenn ich einen Patienten verloren habe und gleichzeitig nicht aus
diesem Job kann, weil das zu viel Versagen wäre. Ich dachte damals, dass wir
jetzt mal an einem entscheidenden Punkt meines Denkens sind und – nachdem ich
das einmal ausgesprochen hatte – vielleicht Lösungsansätze erarbeitet werden
können, wie man da doch raus kommt. Ich hatte sie nochmal um einen Termin
gebeten, aber natürlich läuft alles was bei der Cotherapeutin passiert bei dem
eigentlich zuständigen Bezugstherapeuten zusammen und er hat das wohl als nicht
so nötig erachtet. Es hätte eigentlich noch ein Gespräch mit ihm und der
Cotherapeutin zusammen geben sollen, aber daraus wurde dann nichts, weil die
Cotherapeutin leider an diesem Tag krank war. Also hatte ich ihn alleine vor
mir sitzen und nach einem unendlich langen Monolog sind wir bei der Frage raus
gekommen: „Was sollen wir hier eigentlich noch therapieren?“ Tja, wenn ich das
alles so gut wüsste und könnte, wäre ich wohl nicht da.
Bis zur letzten Woche war es nach dem Therapeutenwechsel schwierig.
Ich war immer noch sicher aufgehoben und auch dafür war ich dankbar, weil ich
auch wusste, dass das in wenigen Wochen, wenn ich wieder mit dem Funk über die
Flure rennen werde, verantwortlich für hunderte von Patienten in der Nacht,
allein eine große Entlastung wäre. Aber therapeutisch haben wir uns nicht von
der Stelle bewegt. Auch dann, als ich mir schriftlich versucht habe Gehör zu verschaffen
bei der leitenden Psychologin, bei der Cotherapeutin und bei Herrn Therapeuten.
Das Einzige, das es zur Folge hatte war, dass Herr Therapeut mich irgendwann
mal nachmittags angerufen und erklärt hat: „Es ist mir wichtig Ihnen zu sagen,
dass wir Sie sehen und registrieren, dass Sie Ihre Fühlerchen überall hin
ausstrecken, um Hilfe zu bekommen.“
Hinsichtlich meines Freundes bin ich noch ein bisschen weiter
gekommen, in dem ich meine Bücher gelesen habe, darüber nochmal auf die
Geschichte von Kevin Hines gestoßen bin und die Zeit hatte mich in aller Ruhe
zu fragen, wie das auch die Sicht, die wir beide aufeinander haben könnten,
verändern kann.
Die letzte Woche hat nochmal ein bisschen etwas bewegt. Am Ende der
Woche davor waren es 19 Monate seitdem mein Freund gestorben war und ich durfte
diesen Brief in der Gruppe vorlesen. Es war ein sehr starker Brief, den ich
glaube ich nur in der Lage war zu schreiben, weil ich einen Boden unter mir
hatte, der mich ein bisschen getragen hatte. Es ist schön, dass die Worte
schwarz auf weiß da sind und mich daran erinnern, wie ich diesen Tod eines
Tages sehen und verarbeitet wissen möchte, aber jetzt – wo ich wieder zu Hause
sitze – erscheinen die Worte ein bisschen gewagt, weil sie viel von der
Sicherheit, die das Schuldprinzip auch ist, mitnehmen.
Danach ging es um das Thema Wut. Die ganze Gruppe schien zu wissen,
worauf ich wütend sein sollte – abgesehen von mir. Irgendwann habe ich diese
Gruppensituation nicht mehr verstanden und war wirklich froh, als die Stunde
vorbei war. Aber ich habe den Herrn Therapeuten dann nochmal gebeten mir das zu
erklären, was er auch getan hat. Ich glaube, das hat nochmal viel in mir
bewegt, ich konnte das nur nicht gut zulassen. Wohin sollte ich mit der Wut am
Abend vor der Entlassung? Eine wütende Mondkind – weiß ich, wie ich mit mir
selbst umgehen soll?
Der Entlasstag war schlimm. Ich wusste, dass ich eigentlich längst
noch nicht bereit bin, meine Flügelchen wieder aufzuspannen und draußen in der
Welt zu bestehen. Es hatte mal wieder gereicht um mich – hoffentlich – wieder
arbeitsfähig zu machen, aber mehr… ? Es gab viele Ideen auch hinsichtlich der
Jobsituation, aber um die umzusetzen brauche ich sicherheitsliebender Mensch
einen Boden unter mir, der trägt. Und ich wusste, dass ich den verlieren werde.
Es war auch wieder Zeit, Menschen gehen zu lassen, die mir doch ans
Herzchen gewachsen waren. Eben weil sie einfach mitgetragen haben. Den ersten
Therapeuten, den ich dort hatte. Ich wollte eigentlich nochmal einen Termin
haben, aber das hatte nicht geklappt. Also ist meine vorerst letzte Erinnerung
an ihn eine Begegnung auf dem Flur, bei der er als Begrüßung die Augenbraue
nach oben gezogen hat und ich ein seltsames Stechen im Herzen verspürt habe.
Die Cotherapeutin, die glaube ich wirklich toll war, ich habe nur leider viel
zu wenig von ihr mitbekommen. Sie konnte Beides: Einen herausfordern und
gleichzeitig halten. Ich durfte nur zwei Mal in diesen sieben Wochen in ihrem
Büro sitzen, ein Mal zum Erklären der Dienstsituation, was sie erstaunlich
ruhig aufgefasst hat und was mich sehr bewegt hat. Und den Bezugstherapeuten,
zu dem sich die Bindung in der letzten Woche bei dem Gespräch über die Wut auch
noch gebessert hat. Meine liebste Mitpatientin, die meine Tischnachbarin war.
Als meine Kraft ganz am Ende des Aufenthaltes doch mal gereicht hat, haben wir
uns ab und an im Speisesaal getroffen und gequatscht, mittlerweile telefonieren
wir.
Zusammenfassend glaube ich, dass diese Klinik wahrscheinlich wirklich
etwas bewegen kann. Die haben tolle und engagierte Therapeuten. Aber man sollte
stabiler sein. Und nicht zwei Wochen damit verbringen, dass es einem so
schlecht geht, dass man zwei Stunden nach der Therapiestunde alles vergessen
hat und es eigentlich nur um mittragen, gehalten werden, gestützt werden, geht.
Auch war dieser Therapeutenwechsel natürlich sehr ungünstig für mich. Und
insgesamt war mein Zustand vermutlich etwas zu schlecht für das Konzept einer
Psychosomatik, die eigentlich mit einigermaßen stabilen Menschen arbeitet – für
alles andere gibt es die Psychiatrie. Hätte der erste Therapeut das wirklich
eingehalten mit den 20 Minuten Einzel pro Woche, hätte ich es dort nicht
durchgehalten.
Ich denke, wenn ich jetzt nochmal vier Wochen Zeit gehabt hätte, hätte
sich vielleicht auch eine Änderung mit der Jobsituation ergeben. Die man hätte
für sich festlegen und dann im therapeutischen Rahmen festzurren müssen, um mit
einem festen Plan im Hinterkopf die Neuro wieder zu betreten. Damit das nicht
so ist, wie die Ankunft zu Hause. Sobald man einen Fuß in alte Gefilde setzt,
fangen sie mich automatisch ein, weil ich mich so sehr nach Zugehörigkeit,
einem zu Hause und einem Ort, an dem ich sein kann sehne, dass ich alles nehme,
was von der Ferne auch nur minimal so aussieht.
Und irgendwie kann man halt bei mir schon den Wecker danach stellen.
Wie sagte Herr Therapeut irgendwann mal so schön: Wir helfen Ihnen dabei, dass
Sie Ihre destruktiven Verhaltensmuster in ein paar Wochen wieder aufrecht
erhalten können.
Es sträubt sich alles in mir, am Montag wieder arbeiten zu gehen. Vom
Dienstplan gehört zu haben, in dem für mich Samstag Tagdienst und Sonntag
Nachtdient vorgesehen sind – also die Dienste, die ich am meisten liebe. Und
Dienstag, damit ich am Mittwoch nach 24 Stunden Dienst bei der Therapeutin
aufschlagen kann und auf ihrem Sessel gedanklich eher schlafe, als irgendetwas
anderes.
Aktuell gibt mir dieser geplante Therapeutenwechsel Halt. Das würde
heißen: Durchhalten bis Sommer, bis meine alte Therapeutin in Rente geht. Und bis dahin die Therapiestunden auf das Nötigste reduzieren, damit nicht so viel Kontingent verloren geht. Und
dann zu dem ersten Kliniktherapeuten, den ich hier hatte. Vielleicht gibt das
etwas. Vielleicht können wir beide den Boden generieren, den ich brauche, um
doch mal etwas zu ändern. Und dann hätte die Klinik doch auch noch Sinn gehabt –
weil sie unabdingbar war, um den Therapeuten überhaupt erstmal kennen zu
lernen.
Nur ein Auto brauche ich bis dahin noch – mal sehen, ob ich das
hinkriege.
Mondkind




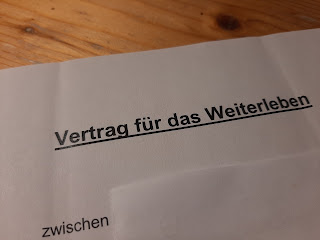







Kommentare
Kommentar veröffentlichen