Rückblick - Mein Jahr 2018
In den letzten Tagen habe ich immer wieder ein Stück am
Jahresrückblick und wahrscheinlich auch letztem Blogeintrag des Jahres 2018
gearbeitet. Eigentlich hatte ich ihn erst morgen hochladen wollen. Da ich aber
jetzt zu einer Freundin und danach direkt in Richtung meines Elternhauses
aufbreche und nicht weiß, wie dort die Situation mit dem Internet für Dinge
aussieht, die nichts mit der Uni zu tun haben, lade ich den Blog lieber jetzt
hoch – stressfrei.
Die Stunden, die ich mit dem Schreiben verbracht habe, waren sehr
emotional – an manche Dinge habe ich mich erst erinnert, als meine Finger aus
dem Knäuel in meinem Kopf, Worte geformt haben.
Wer Lust und Zeit hat, holt sich am besten einen Kaffee oder einen
Tee, setzt sich in eine ruhige Ecke und begleitet mich noch einmal durch die
letzten zwölf Monate im Schnelldurchlauf. Vielleicht ist das auch für
diejenigen interessant, die den Blog noch nicht so lange lesen.
Ich möchte den Anlass nutzen und an der Stelle auch nochmal allen
Lesern danken, die gedanklich bei mir waren. Ebenso war ich hin und wieder
gerührt von den Nachrichten, die mich auf verschiedensten Wegen erreicht haben,
mir manchmal Mut gemacht haben, aus der Patsche geholfen haben oder die einfach
nur gezeigt haben, dass Menschen meinen Weg gedanklich begleiten.
Ich wünsche Euch allen einen guten Start in das Jahr 2019. Es ist die
erste Seite eines neuen Kapitels. Kein kompletter Neuanfang, da jedes Kapitel
in einem Buch auf dem vorhergehenden Kapitel aufbaut. Aber dennoch vielleicht
eine gute Gelegenheit, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche Euch
neben Gesundheit – ganz viel davon… - den Mut, dass viele der Wünsche,
Hoffnungen und Ideen, die in Euren Köpfen herum geistern, in die Realität
umgesetzt werden können.
 | |
| Neuer Kalender... - gekauft habe ich ihn in einem winzigen Laden im Dorf | . |
Als Erinnerung an das letzte Jahr und daran, dass dieser Kalender zurück "nach Hause" soll
***
I wanted to let go and give up the fight
Tell my heart it can stop beating
You gave me a reason to believe in myself
Just when I'd given up dreaming
Tell my heart it can stop beating
You gave me a reason to believe in myself
Just when I'd given up dreaming
(Ronan Keating – Just when I’d given up dreaming)
In den letzten drei Jahren schreibe ich in meinen Rückblicken immer,
dass es ein turbulentes Jahr war. So auch dieses Jahr wieder. Werfen wir einen
Blick zurück auf den letzten Eintrag aus 2017.
Kurzer Blick auf nächstes Jahr.
Geplant ist es, jetzt bis April
den Lernplan zu verfolgen, dann das Examen zu schreiben und dann habe ich noch
einen Monat frei. Was ich in der Zeit mache, weiß ich noch nicht.
Und dann beginnt – wo auch immer
– das PJ. Vielleicht werde ich den Großteil meines Jahres sehr weit weg
verbringen.
Vielleicht bin ich in 12 Monaten
auch dankbar für das Jahr. Vielleicht habe ich dort unten irgendwie Fuß
gefasst, Freunde gefunden, einen idealen Ort zum Arbeiten. Denn trotz aller
Ängste die das jetzt mit sich bringt, hatte ich schon meine Gründe, so sehr an
diesem Ort festzuhalten.
Vielleicht findet sich alles
irgendwie
Es ist ein bisschen unglaublich. Hätte mir zu dem Zeitpunkt, an dem
dieser Eintrag entstanden ist jemand gesagt,
dass ich heute hier sitze, mit einem Examen, das besser ist, als ich es mir zu
dem Zeitpunkt erträumt hatte, mittlerweile die ersten 2/3 des PJs geschafft
habe und wirklich sehr dankbar für die letzten Monate bin – wahrscheinlich
hätte ich es nicht für möglich gehalten. Ich habe mir viel gewünscht, viel
gehofft, ich hatte meine Vorstellungen. Aber dass es alles wirklich klappt –
teilweise sogar noch besser als erhofft… - es ist erstaunlich.
Und wenn man bedenkt, dass ich mir nach dem Examen nicht sicher war,
ob ich das Ende des Jahres noch erlebe… - zu tief saß die Angst, dass dieser Ort
in der Ferne doch nur ein Traum, ein Stück Illusion ist. Dass all das, wofür
ich so lange gekämpft habe, gar nicht existiert... – dann ist es noch ein
bisschen erstaunlicher.
Aber gehen wir zurück. Zu den Anfängen des Jahres 2018. Januar. Der
Lernplan hatte gerade erst begonnen. Zwar hatte ich einen Plan aufgestellt, ich
hatte die Tage durchgezählt, nummeriert und für jeden Tag gab es ein von mir
selbst zusammengefasstes Script. Aber was da vor mir lag, war ein sehr großer
Berg von Arbeit. Allzu viele Krisen zwischendurch konnte ich mir nicht leisten.
Die Aussicht auf die Art die Tage bis Mitte April zu verbringen, war ehrlich
gesagt nicht besonders verlockend.
Die Therapeutin war so lieb und hat mir kleine Etappen gebastelt, in
dem sie auf beinahe jeden Donnerstag einen Termin gelegt hat. Immer wenn es ging
auch in den Randbereich, sodass ich nicht mitten am Tag mein Programm
unterbrechen musste.
Meine Tage starteten morgens um 6 Uhr am Schreitisch mit einem Kaffee.
Und während es draußen innerhalb der nächsten drei Stunden hell geworden ist,
habe ich die ersten Seiten auswendig gelernt. Mittags waren immer Einkaufen, Putzen oder sonstige Erledigungen dran, die gerade anstanden, um die
Mittagspause produktiv zu nutzen. Und dann ging es bis in die späten
Abendstunden weiter. Zu Beginn habe ich noch versucht, die Freunde regelmäßig
zu sehen. Aber es war ein Unterfangen, das ziemlich aussichtslos war. Ich habe
mich tagelang damit gestresst, an einem Nachmittag oder Abend mal zwei freie
Stunden zu basteln, sodass ich es dann gegen Ende Januar ganz eingestellt habe.
Mir war bewusst, dass es sein könnte, dass die Freunde das nicht verstehen,
aber es war auch die Vorbereitung auf eine der größten Prüfungen meines
bisherigen Lebens.
 |
| Wenn ich bedenke, dass diese Bilder bald wieder kommen... |
 |
 |
| Kakao - Pause... - das sollte ich auch 2019 wieder einführen 😋 |
Nachdem mir so viele Leute erzählt hatten, dass die Zeit der
Examensvorbereitung die schlimmste ihres Lebens gewesen sei, fand ich es sehr
überraschend, dass ich das streckenweise sogar als relativ entspannt erlebt
habe. Ich wusste jeden Tag genau, was ich zu tun hatte; das Examen war noch
einige Wochen entfernt. Es gab keine blöden Situationen in der Uni oder in
Famulaturen, in die man hinein laufen konnte; keinen der einem den ganzen Tag
verständlich gemacht hat, was man alles nicht kann. Wenn ich donnerstags von
meiner Therapeutin zurück ins Studentenwohnheim geradelt bin, meinte ich zu
wissen, was passiert, bis ich wieder dort aufschlage. Und für einen Menschen
wie mich, war diese Vorhersehbarkeit sehr beruhigend.
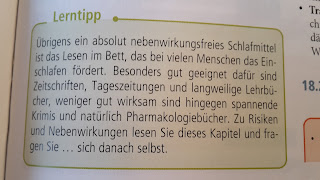 |
| 😂 Wenigstens gab es hin und wieder etwas zu lachen... |
 | |||
| Der Stapel an durchgearbeiteten Scripten wuchs... 👍 |
Zwischendurch gab es immer wieder Situationen, die mich aus dem
Konzept gebracht haben. Manchmal waren die familiärer Natur, manchmal hat die
Therapeutin mich gestresst. Zum Beispiel damit, dass sie mich eigentlich ab
Ostern an wen anders abgeben müsse, spätestens aber nach dem Examen. Meine
damalige Lebensversicherung geriet ein wenig ins Wanken. Auf absehbare Zeit
würde ich ganz alleine auf meinem Pfad unterwegs sein und das hat sehr viel
Angst gemacht.
Irgendwann musste ich mir auch die Frage stellen, wie und wo ich mein
PJ machen möchte. „Mein“ Neuro – Oberarzt hatte mir Ende 2017 geschrieben
„Mondkind, wir können jetzt auch Innere.“ Und während ich mich im ersten Moment
über den Satz gefreut hatte, bedeutete das auch eine Menge Unsicherheit. Dass
mein Herz an diesem Ort hängt, das wusste ich. PJ an einem kleinen
Kreiskrankenhaus schien verlockend, aber wie soll das bitte beinahe acht Monate
ohne Stütze gehen? Der Neuro – Oberdoc und ich – wir kannten uns zwar, aber
noch nicht so gut. Und dass da im Sommer irgendwann ein Pfarrer auftauchen und
die Sache mittragen wird, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht – sonst hätte
ich mich im Leben nicht so verrückt gemacht.
Nachdem ich dem Oberarzt der Neurologie meine Bedenken mitgeteilt und
ihn auch erstmalig erklärt hatte, warum ich jetzt überhaupt ein halbes Jahr
später dran bin als geplant, kam eine ganz liebe Mail zurück. So etwas
ähnliches habe er sich schon gedacht, da man neben der Zielstrebigkeit, dem Ehrgeiz
und der Professionalität auch etwas ganz Zerbrechliches an mir bemerke und er
werde mir helfen, wo er könne. Wenn ich das wollte, dann würden wir das
hinbekommen. Wir…
Ich weiß noch genau, wie eine Freundin und ich in ihrer Küche standen
und darüber debattiert haben, ob ich es mache oder nicht. Und darauf gekommen
sind, dass es in Krisen einfach schwierig werden wird, weil Hilfe schwer
erreichbar ist. Die Freundin stellte damals fest, dass es für mich nicht ganz
ungefährlich ist, dort runter zu gehen. Hatte ich in der Studienstadt immer die
Ambulanz als Versicherung im Rücken auch in schweren Krisen nicht daran kaputt
gehen zu müssen, solange wie ich noch in der Lage bin das dort zu
kommunizieren, würde die Sache mitten auf dem Land anders aussehen.
Aber es würde auch eine Chance für mich sein. Ich könnte viel lernen
in einem kleinen Haus, ich könnte in der Neuro Fuß fassen und immerhin hatte
ich dort auch schon gute Zeiten verbracht.
Am Ende wurde es ein „Ja“ für die acht Monate. Nicht ohne, dass ich
mich danach beinahe täglich gefragt habe, ob es die richtige Entscheidung ist.
Während ich weiterhin emsig für das Examen gelernt habe, ist Frühling
geworden. Irgendwann fiel mir bei meinen wöchentlichen Fahrten an die Ambulanz
in der Uni auf, dass die Kirschbäume wieder blühten und kurz darauf die ersten
hellgrünen Blätter zu sehen waren. Die Vögel kamen wieder, jenseits der
Fensterscheiben kehrte das Leben zurück.
Es wurde warm draußen, ohne dass ich es gemerkt hatte und so kam es, dass ich
bei beinahe 20 Grad mit Winterjacke los fuhr zum Einkaufen.
 |
| Noch war Winter... |
 |
| Ich hoffe mein viertes Fach wird nicht Epidemiologie... |
 |
| Frühling... ! Ich liebe die Kirschbäume - und von denen gibt es bei mir viele!💛 |
Vor dem Examen stellte sich dann die Frage, wie man nach dem Examen
weiter macht. Der Gedanke an das PJ hat mich zusammen mit der Therapeutin über
die Wochen gezogen. Was immer im Hintergrund mitlief, war die latente
Suizidalität. Mal stand sie mehr im Vordergrund, mal weniger. Mal wusste ich
nicht, ob ich das PJ überhaupt noch erleben wollte – zu groß war die Angst, dort
unten doch in aller Einsamkeit unter zu gehen. Zwar hatte der Neuro – Oberarzt
viel geredet, aber würde er wirklich für mich da sein? Kann ich mit meinem
Chaos – Kopf überhaupt eine gute Ärztin sein? Schaffe ich es, auf die Patienten
einzugehen? Kann ich überhaupt irgendetwas? Und wenn sich das alles als nicht
machbar herausstellt – was bleibt dann noch? Ich bestehe doch quasi nur aus
Uni…
Nach und nach formte sich der Plan, die fünf Wochen nach dem Examen
nochmal für einen Klinikaufenthalt zu nutzen. Während man von anderen gehört
und gelesen hat, die nach dem Examen erstmal in die Karibik fliegen, haben die
Therapeutin und ich sich Gedanken gemacht, wie man das möglichst zeitnah nach
dem Examen organisieren kann.
Daneben bestand die Angst, dass ich nach dem Examen ohnehin völlig
zusammen breche. Der Druck funktionieren zu müssen würde nicht mehr da sein und
darüber hinaus hatte die Therapeutin angekündigt, in der Woche nach dem Examen
den letzten Termin mit mir zu machen.
Rückblickend betrachtet wundere ich mich, wie das überhaupt alles
ausgehalten habe. Das Examen vereinnahmt einen ja in diesen Tagen voll und ganz
und nebenbei lief vieles aus dem Ruder. Am Morgen des zweiten Examenstages wurde
dann auch klar, dass meine Mutter mir hinsichtlich der Idee Klinik einen Strich
durch die Rechnung macht. Unter der Androhung schuld zu sein, wenn meine
Schwester das Auto auf dem weiten Weg quer durch Deutschland zu unserer
Oma an die Leitplante fährt und mit der
Aussicht den Geburtstag in Paris zu verbringen, was bereits gebucht worden sei,
meinte ich kaum noch eine Chance zu haben.
Wenn ich es heute überdenke frage ich mich ein bisschen, warum ich
mich da habe so erpressen lassen. Aber es lag so viel Druck auf mir wegen des
Examens und der Aussicht, dass ich kurz vor dem PJ völlig auseinander falle,
dass ich nicht mehr klar denken und mich nicht auf die Hinterfüße stellen
konnte.
 |
| Drei Tage - drei Hefte! Und bestanden 😃 (Wahrscheinlich bewahre ich die bis zum Ende meines Lebens auf...😂) |
Und so wurden diese fünf Wochen bevor das PJ startete, mehr oder
weniger ein Alptraum. An die Fahrt zu meiner Oma habe ich ehrlich gesagt kaum
noch Erinnerungen und auch Paris verschwimmt vor meinem geistigen Auge -
abgesehen von dem Attentat, das vor unserem Hotel stattgefunden hat. Die
zerbrochene Glastür beim Bäcker nebenan, das Blut und die Kleidung auf der
Straße, das weiße Tuch, das über einem toten Mensch auf der Straße lag
eingetaucht in Blaulicht und Sirenen, die die Dunkelheit der Nacht zerrissen
haben. Und die Frage, warum die Menschheit so grausam ist. Warum Menschen, die
auf dem gleichen Planeten unter der gleichen Sonne leben, die doch alle nur ihr
Leben leben wollen – warum sie sich gegenseitig töten.
 |
| Die Stadt, in der ich geboren wurde... |
 |
 |
| Auf einer Wanderung... |
 |
| Na, wer kennt's? |
 |
| Paris... - einziger "Urlaub" dieses Jahr |
 |
| Und das ist meine Wenigkeit... |
Zwischendurch gab es noch ein paar Mails zwischen dem Neuro - Oberarzt
und mir. Ich glaube, er hat mir mindestens drei Mal zum Examen gratuliert, hat
sich glaube ich mehr gefreut als irgendwer anders und irgendwie hat er mir über
die Tage bewusst gemacht, dass ich da doch einen riesigen Meilenstein
geschafft hatte.
Allmählich packte ich nach und nach meine Sachen zusammen – mit vielen,
vielen Zweifeln. Hätte ich gewusst, wie sich am Ende alles fügen würde, hätte
ich mir nicht halb so viele Sorgen gemacht – aber das wusste ich nicht.
Der Umzug war ein Kraftakt. Mein ganzes Hab und Gut wurde in zwei
Autos verstaut. Damit es passt, hat mein Vater einiger der Kisten wieder
ausgepackt – und ehrlich gesagt war ich gar nicht begeistert davon, dass mein
Besitz so inspiziert werden konnte.
Altbekannte Straßen. Ein komisches Gefühl. So vertraut irgendwie. Als
sei man nie so richtig weg gewesen. Mein Vater fuhr sofort wieder, meine
Schwester einige Tage später und dann stand ich da – in meiner recht luxuriösen
PJler – Wohnung und wartete den ersten Tag ab.
Erster PJ – Tag in der Inneren. Es war chaotisch. Überhaupt nicht, wie
ich mir das vorgestellt hatte. Alle waren im Stress. Der Chef war nicht da, ich
wurde schnell einer Oberärztin zugeschoben, die mich erst mal ausfragte, was
ich denn alles schon gemacht hätte - was nicht sonderlich viel war. Noch nie
Stationsarbeit gemacht, noch nie in der Notaufnahme gearbeitet, noch nie
Rettungsdienst gefahren. Wie sollte ich dem Krankenhaus irgendetwas nutzen? Sie
hat mich dann erstmal einer Ärztin zugeordnet, die mich mit der Aussage
„Mondkind mach mal Kurvenvisite“ im Schwesternzimmer zurück gelassen hat. „Was
zum Geier ist eine Kurvenvisite?“, fragte ich mich und blätterte planlos durch
die Akten. Als sie wiederkam hatte ich was getan…? Nichts.
Zweiter Auftrag. „Mondkind, geh mal ins Zimmer 218 und mach Visite.“
Erstmal zuschauen zu dürfen, wäre ja schon nett gewesen. Und bei dem Gegacker,
das hinter mir los ging war mir auch klar, dass da irgendwo ein Haken sein
musste. Und da war auch einer. Ein Gewaltiger. Eine Patientin, die ich
überhaupt nicht kannte, die mir erklärte, dass alle Medikamente nichts brächten
und die sich darüber echauffierte, dass wir sie nicht ins Thoraxzentrum
verlegen. Ich versprach das mit den Kollegen abzusprechen und habe – nachdem
ich eine ¾ Stunde später endlich aus dem Zimmer war – erstmal eins auf den
Deckel bekommen für die Nachfrage, ob wir die Patientin auf ihren Wunsch hin
verlegen können. Was ich nicht wusste war, dass die Patientin quasi Dauergast
war. Allein in diesem Jahr hatte sie schon über 20 Aufenthalte hinter sich – es
war mehr ein soziales Problem, als irgendetwas anderes.
Wenn das jetzt wochenlang so weiter gehen würde… - so hatte ich mir
das nicht gedacht.
Tags darauf war ich das erste Mal in der Neuro. An der Rezeption
vorbei, die Treppen hinab, den gelben Pfeilen mit der Aufschrift Notaufnahme
folgen und kurz davor rechts in den Diagnostikflur abbiegen. Und da stand er
dann… - „mein“ Neuro – Oberarzt. Nach so langer Zeit wurde erstmal eine
Umarmung fällig.
Wir haben über das PJ geredet und er hat mir erklärt, das sei wie
Fahrschule. Am Anfang mache man alles mit dem Fahrlehrer zusammen, sodass er
immer sofort korrigierend eingreifen kann und nach und nach zieht sich der
Fahrlehrer immer mehr zurück, lässt einen allein über die Landstraße und gegen
Ende das erste Mal alleine auf die Autobahn fahren.
An diesem Abend war ich das erste Mal der Überzeugung, dass es sich
alles gelohnt hatte. Und dass es werden würde.
Dieses „Fahrschulkonzept“ hatten die Kollegen der Kreisklinik noch
nicht verinnerlicht. Am zweiten Tag hatte man mich in die Notaufnahme gestellt,
nicht selten hatte ich noch den Pieper dazu und sollte mich um halb sterbende
Omas mit einer Lungenentzündung oder Herzinsuffizienz kümmern, die nach Luft
japsend und mit schlechter Sättigung zu uns rein geschoben wurden.
Zum Glück war die Oberärztin, auf die ich am ersten Tag getroffen war,
sehr begeistert, nachdem ich einem Patienten mit Schwindel und einigen
Ergebnissen aus einer Vordiagnostik einen Morbus Meniere diagnostizierte und
sich das als richtig heraus stellte, sodass sie mir erlaubte anzurufen, wann
immer etwas ist. Auch die anderen Kollegen stellten sich als ziemlich nett
heraus und diejenige, die mich am ersten Tag so hatte ins Messer laufen lassen,
war die letzten zwei Wochen da – die Kündigung war schon längst eingereicht.
Das erklärte einiges. Ich war froh, als sie ging.
Nach und nach lebte ich mich auf der Inneren ein und bastelte mir
einen geregelten Tagesablauf. Zu spät kam ich fast immer aus dem Krankenhaus,
aber die warmen Sommerabende genoss ich zumeist im Park. Irgendwann wechselte
ich von der Notaufnahme auf die Station. „Nur“ Stationsarbeit blieb aber nicht
lange meine Tätigkeit, denn mit Krankenstand und Kündigungen konnte die
Notaufnahme kaum noch bewältigt werden. Und nachdem ich auch noch einen
Einblick auf die Palliativstation gewonnen hatte, half ich dort auch regelmäßig
aus.
Es war ein bisschen wie eine Sucht. Ich wusste, dass die mich da
völlig überfordern, auch wenn ich das lange Zeit nicht gespürt habe, aber ich habe auch viel Anerkennung für das bekommen, was
ich getan habe. Und ich habe bemerkt, dass ich die Arbeit leisten kann - das war ja immer meine Angst. Dass Studieren noch geht, ich im Krankenhausalltag aber nicht mehr zurecht komme.
Irgendwann platzte die Notaufnahme aus den Nähten. Die Palliativstation war emotional anstrengend - da halfen auch die „Dienstags – Gespräche“ im "Wohnzimmer" mit allen Ärzten, Pflegern und Therapeuten nur wenig. Unsere halbe Normalstation war voller Krebskranker, die starben wie die Fliegen. Und ich war in allen drei Nadelöhren gleichzeitig beschäftigt; mein Telefon stand nicht mehr still.
Irgendwann platzte die Notaufnahme aus den Nähten. Die Palliativstation war emotional anstrengend - da halfen auch die „Dienstags – Gespräche“ im "Wohnzimmer" mit allen Ärzten, Pflegern und Therapeuten nur wenig. Unsere halbe Normalstation war voller Krebskranker, die starben wie die Fliegen. Und ich war in allen drei Nadelöhren gleichzeitig beschäftigt; mein Telefon stand nicht mehr still.
Und nein, ich wusste nicht immer genau, was ich da tue. Gar nicht mal
immer unbedingt fachlich - da hat man mir ein Nachfragen oft auch nicht krumm genommen. Aber wo ist im System was zu hinterlegen, wo melde
ich welche Untersuchung an, damit die dann auch stattfinden? Und immer wenn
etwas nicht geklappt hat: War es mein Fehler? Habe ich irgendetwas übersehen,
zu spät gesehen, bin ich dafür verantwortlich, dass es dem Patienten jetzt
schlecht geht, hätte ich ihm prophylaktisch eine Antibiose geben müssen, stirbt
der jetzt heute Nacht auf der Intensivstation?
Langsam aber sicher rutschte ich ab. Über zwei Wochen lang habe ich
jede Woche bestimmt drei Mal mit der Therapeutin telefoniert – was sie wohl
irgendwann dazu animiert hatte, einen möglichen Klinikaufenthalt einzufädeln,
ohne dass sie mir davon berichtete. Es war das Gesamtpakt, das mich immer mehr
überfordert hat. Die Arbeit in der Kreisklinik, die Aussicht auf die Neuro, die
nach den letzten Jahren viel aufzuwiegen hatte.
 |
| Telefon und Diktiergerät - Grundausstattung auf der Inneren |
 |
| Ich liebe den Park so, so sehr! |
 |
| Blick über den Campus |
Ich weiß bis heute nicht, wie ein einzelner Mensch so viel Glück haben
kann. Genau im richtigen Moment, als mir klar wurde, dass die Therapeutin mir
nicht mehr reicht, ich dem Neuro – Oberarzt schlecht zwei Wochen vor der Neuro
erzählen kann, dass es alles nicht mehr geht, hat mich der Seelsorger eines
Tages im Arztzimmer angesprochen.
Ich kannte ihn schon aus unseren „Dienstags – Gesprächen“ von der
Palliativstation und hielt ihn schon vorher für einen sehr sympathischen
Menschen. Ich war wie ein Vulkan. All die Überforderung, all die Sorgen der
letzten Wochen sprudelten aus mir heraus. Er schlug mir vor, dass wir beide uns
nochmal in Ruhe zusammen setzen könnten. Ich solle auf ihn zukommen. Nachdem
ich das zwei Nächte überschlafen hatte und ihn nach einem Termin fragte,
stellte sich heraus, dass er erstmal eine Woche im Urlaub ist – also so wie
immer, wenn man ganz dringend Hilfe braucht.
In der Zwischenzeit war mir klar geworden, dass ich das eigentlich organisieren
können müsste, zwei Wochen in die Klinik zu gehen in der Hoffnung, dass es
danach etwas besser geht und ich das PJ irgendwie retten kann. Aber ich müsste
es natürlich in der Neuro absprechen. Also habe ich dem Oberarzt der Neuro
Bescheid gesagt, dass wir ganz dringend miteinander reden müssen – und am
späten Nachmittag saß ich auf dem grünen Stuhl in seinem Büro, er übereck.
Wie erklärt man jemandem, dass es einfach nicht mehr geht? Dass man
zwar noch da sitzt, aber dass man nicht mehr weiß, wie man noch einen einzigen
Tag überstehen soll? Und wie kann das eine Woche vor der Neuro passieren? Ich
war unfassbar verzweifelt.
„Mondkind, gib uns die erste Woche“, hat er nach einer langen Pause
vorgeschlagen. „Du darfst alles machen. Du darfst hier zitternd und
hyperventilierend bei mir im Büro sitzen, weinen oder mal eher gehen – aber gib
uns die erste Woche, wenn Du das irgendwie aushältst. Und nächsten Freitag
setzen wir uns nochmal zusammen und wenn es dann immer noch nicht geht – dann
darfst Du fahren…“
Ich war nicht begeistert davon, aber ich wusste auch irgendwo, dass er
Recht hatte. Ein Teil der Krise rührte sicher von der Angst her, dass meine
idealisierte Neuro nicht so werden würde, wie ich mir das erhofft hatte – und
weglaufen würde das nicht besser machen.
Start auf der Neuro. Es war wieder eine Umstellung. Entschleunigung.
In der ersten Woche sollte ich Zuschauer sein, was nach meinem Einsatz in der
Inneren so gar nicht meine Sache war. „Mondkind, ich kann mir vorstellen, dass
es Dir damit gerade nicht gut geht, weil Du vollkommen unterfordert bist“,
schlussfolgerte der Neuro – Oberdoc irgendwann.
Während ich auf der Inneren mit Arbeit einfach zugeschüttet wurde,
musste ich mich auf der Neuro aktiv darum bemühen, überhaupt welche zu bekommen.
Es war ungewohnt und ich hatte Angst, dass man mir keine Arbeit gibt, weil man
mich für inkompetent hält - mit Unterforderung hatte das nicht viel zu tun.
In der zweiten Woche hat der Neuro – Oberdoc dann meine Doppler –
Sonographie – Kenntnisse aufgefrischt und ich war auch öfter in der Notaufnahme.
Allerdings jeden Tag mit einem anderen Kollegen und das war auch nicht so
meins. Außerdem wollte der Neuro – Oberdoc, dass ich mehr Stationsarbeit mache.
Man war zufrieden mit dem was ich da tue und ich wusste gar nicht
genau warum – weil ich gefühlt nichts gemacht habe. Aber mit der Zeit kam ich
auf der Stroke – Unit an. Ehe nach fünf Wochen der erste Wechsel auf die
periphere Station folgte.
 |
| Ergebnisse des "privaten Sonokurses" |
Auch hier hieß es, dass ich eigene Patienten betreuen sollte –
allerdings habe ich auch hier wochenlang darum gekämpft, dass man mir endlich
eigene Patienten gibt. Als das dann aber endlich klappte, habe ich selbst
gemerkt, dass ich eine Menge auf dem Kasten hatte.
Anfang November folgte dann endlich – nachdem es mir wochenlang
angekündigt wurde und ich sehr viel Angst davor hatte – die erste eigene
Lumbalpunktion. Vorzugeben zu wissen was man tut, bei völliger
Ahnungslosigkeit. Normalerweise bin ich, was ärztliches Handwerk anbelangt,
nicht sonderlich begabt, aber das klappte wirklich gut. Es war eine riesige
Erleichterung. Abgesehen von der Intensivstation wird es auf der Neuro nicht
mehr invasiver. Auch die folgenden Punktionen verliefen erfolgreich und ich
hatte schon bald den Ruf als „Lumbalpunktions – Königin.“ Aber wer jetzt
glaubt, dass Lumbalpunktion wie im Lehrbuch läuft… - Fehlannahme. Theoretisch
muss es da zwei Mal einen Widerstandverlust geben. Bei verschlissenen
Wirbelsäulen merkt man davon nicht viel. Aber zumindest lernte ich irgendwann
zu unterscheiden, ob ich gerade in einem Band oder auf dem Knochen festhänge,
was schon mal nicht schlecht ist.
Alle paar Wochen - auf der Inneren mehr und in der Neuro weniger - gab es Fahrten in die Studienstadt. Meistens war viel zu tun. Im Labor vorbei, die Freunde sehen und ein Termin bei der Therapeutin - und all das nach einer schlaflosen Nacht im Bus. Diese "Ausflüge" in die "alte Heimat" waren ein zweischneidiges Schwert. Ich mochte es, all die Menschen wieder zu sehen, aber es war auch ein Pendeln zwischen den Welten. Meistens ist mir erst hier aufgefallen, wie sehr ich die Studienstadt doch auch vermisse. Die Altstadt mit dem Fluss, der sie durchzieht, hat etwas. Unmittelbar nach dem Klinikaufenthalt, als es mit der Freizeitgestaltung mal etwas besser klappte, war ich oft am Fluss gewesen und das sind auch einige gute Erinnerungen - auch wenn das Studium im Gesamten sonst sicherlich nicht zu den Sternstunden gehört. Immer wieder fragte ich mich, ob ich wirklich schon wieder von vorne anfangen will. Und ob ich in der Ferne wohl irgendwann Anschluss finden werde - auch außerhalb der Klinik.
Meistens war ich sonntags verwirrt, wenn ich wieder in meiner Wohnung im Dorf stand. Während es in der einen Welt mittlerweile ein Privatleben gibt, gibt es in der anderen Welt ein Arbeitsumfeld, das ich mir besser nicht wünschen könnte. Wenn man bedenkt, dass ich nach 30 Tagen Famulatur meistens die Nase voll vom Krankenhaus hatte, war das ein kleines Wunder, dass ich im PJ nicht das Bedürfnis hatte, dass es endlich vorbei ist.
Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst war, dann war ich einerseits enttäuscht, wenn ich wegen der Prüfungen in der Neuro nicht in die Studienstadt konnte, aber andererseits ersparte mir das auch eine Menge Kopfchaos.
Was mich auf der Neuro zu Beginn auch gestresst hat war, dass Mittagessen gehen ein fester Bestandteil auf dem Tagesplan ist und eine gute Gelegenheit darstellt, um ein bisschen Socialising zu betreiben. Wer unter den Assistenten nicht essen geht, war fast ein bisschen ein Außenseiter.
Zwar war die Anorexie bei mir eigentlich kurz nach dem Auszug aus dem Elternhaus Geschichte, aber das hieß nicht, dass essen mich nicht immer stresste. Zwar war ich im Normalgewicht, aber das Mittagessen ließ ich so gut wie immer ausfallen. Allerdings muss ich sagen, dass sich auch mit Mittagessen kaum etwas an meinem Gewicht getan hat. Auch wenn ich es selbst abends häufig nicht lassen konnte, mich in meiner Küche auszutoben.
Ich friere nicht mehr so viel - das ist mir angenehm aufgefallen. Ich glaube, die letzten Monate haben mein Verhältnis gegenüber dem Essen beinahe komplett normalisiert. Ich mache mir echt keine Gedanken mehr darüber.
Ich hoffe das bleibt so. Trotz Chirurgie, trotz der Tatsache, dass man aus allen Ecken hört, dass es an der Uni keine geregelten Pausenzeiten gibt. Trotz, dass wieder eine stressige Examenszeit ansteht. Und dass ich quasi keine Küche mehr habe, darf man auch nicht vergessen. In der Studentenbude gibt es keine vernünftige Arbeitsplatte, bis das Wasser im Kochtopf kocht, ist man davor verhungert und den Luxus eines Ofens gibt es auch nicht. Und ich habe schon in den letzten Tagen festgestellt, dass es in der "Küche" einfach überhaupt keinen Sapß mehr macht.
Alle paar Wochen - auf der Inneren mehr und in der Neuro weniger - gab es Fahrten in die Studienstadt. Meistens war viel zu tun. Im Labor vorbei, die Freunde sehen und ein Termin bei der Therapeutin - und all das nach einer schlaflosen Nacht im Bus. Diese "Ausflüge" in die "alte Heimat" waren ein zweischneidiges Schwert. Ich mochte es, all die Menschen wieder zu sehen, aber es war auch ein Pendeln zwischen den Welten. Meistens ist mir erst hier aufgefallen, wie sehr ich die Studienstadt doch auch vermisse. Die Altstadt mit dem Fluss, der sie durchzieht, hat etwas. Unmittelbar nach dem Klinikaufenthalt, als es mit der Freizeitgestaltung mal etwas besser klappte, war ich oft am Fluss gewesen und das sind auch einige gute Erinnerungen - auch wenn das Studium im Gesamten sonst sicherlich nicht zu den Sternstunden gehört. Immer wieder fragte ich mich, ob ich wirklich schon wieder von vorne anfangen will. Und ob ich in der Ferne wohl irgendwann Anschluss finden werde - auch außerhalb der Klinik.
Meistens war ich sonntags verwirrt, wenn ich wieder in meiner Wohnung im Dorf stand. Während es in der einen Welt mittlerweile ein Privatleben gibt, gibt es in der anderen Welt ein Arbeitsumfeld, das ich mir besser nicht wünschen könnte. Wenn man bedenkt, dass ich nach 30 Tagen Famulatur meistens die Nase voll vom Krankenhaus hatte, war das ein kleines Wunder, dass ich im PJ nicht das Bedürfnis hatte, dass es endlich vorbei ist.
Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst war, dann war ich einerseits enttäuscht, wenn ich wegen der Prüfungen in der Neuro nicht in die Studienstadt konnte, aber andererseits ersparte mir das auch eine Menge Kopfchaos.
Was mich auf der Neuro zu Beginn auch gestresst hat war, dass Mittagessen gehen ein fester Bestandteil auf dem Tagesplan ist und eine gute Gelegenheit darstellt, um ein bisschen Socialising zu betreiben. Wer unter den Assistenten nicht essen geht, war fast ein bisschen ein Außenseiter.
Zwar war die Anorexie bei mir eigentlich kurz nach dem Auszug aus dem Elternhaus Geschichte, aber das hieß nicht, dass essen mich nicht immer stresste. Zwar war ich im Normalgewicht, aber das Mittagessen ließ ich so gut wie immer ausfallen. Allerdings muss ich sagen, dass sich auch mit Mittagessen kaum etwas an meinem Gewicht getan hat. Auch wenn ich es selbst abends häufig nicht lassen konnte, mich in meiner Küche auszutoben.
Ich friere nicht mehr so viel - das ist mir angenehm aufgefallen. Ich glaube, die letzten Monate haben mein Verhältnis gegenüber dem Essen beinahe komplett normalisiert. Ich mache mir echt keine Gedanken mehr darüber.
Ich hoffe das bleibt so. Trotz Chirurgie, trotz der Tatsache, dass man aus allen Ecken hört, dass es an der Uni keine geregelten Pausenzeiten gibt. Trotz, dass wieder eine stressige Examenszeit ansteht. Und dass ich quasi keine Küche mehr habe, darf man auch nicht vergessen. In der Studentenbude gibt es keine vernünftige Arbeitsplatte, bis das Wasser im Kochtopf kocht, ist man davor verhungert und den Luxus eines Ofens gibt es auch nicht. Und ich habe schon in den letzten Tagen festgestellt, dass es in der "Küche" einfach überhaupt keinen Sapß mehr macht.
Mit der Zeit bemerkte ich, dass die Neuro wirklich mein Fachgebiet
wird. Ich mag dieses zusammenpuzzeln von Einzelteilen, das
differentialdiagnostische Denken. Ich mag es, dass man viel eigenes Hirn
braucht, um die Patienten richtig zu betreuen. Und ich finde die
Krankheitsbilder so faszinierend. Die Neurologie scheint für mich fast ein
bisschen eine eigene Welt zu sein. Die Menschen wollen Vorhersehbarkeit,
Kausalzusammenhänge. Wenn X passiert, musst Du Y tun. Kommt ein Mensch mit
Gallenkoliken, nimmst Du ihm die Gallenblase raus, dann geht es ihm wieder gut.
Medizin funktioniert, wie eine große Maschinerie. Die Krankenhäuser wollen
Gewinne machen, die Krankenkassen wenig zahlen, die Menschen wenig Ausfall. Dem
kann sich auch die Neurologie nicht entziehen. Aber das Gehirn funktioniert so
nicht. Das Gehirn hat eigene Pläne. Motorische Ausfälle mögen noch sehr
vorhersehbar sein, aber wie die Psyche reagiert – das ist zum Teil sehr
individuell. Und am Ende gibt es auch immer wieder kleine Wunder. Wie der Mann,
der im hyperglykämischen Koma lag – wochenlang. Der Oberarzt mahnte immer zur
Geduld – das Gehirn brauche Zeit. Und plötzlich ging es ganz schnell –
innerhalb von ein paar Tagen saß er morgens im Bett und hat uns einen Schwenk
aus seinem Leben erzählt.
Neurologie ist sehr individuell, es sind keine Prozesse, sondern der
Mensch, der in den Mittelpunkt gerückt werden muss und damit birgt jeder Fall
neue Aspekte und neue Dinge, die bedacht werden müssen.
Der Neuro – Oberdoc hat mich zum Lernen animiert durch die mündlichen
Prüfungen, die absolviert werden mussten. Ich habe in der Zeit zwei große
Ordner erstellt, habe thematisch Lernzettel zu den großen Themen wie Schlaganfall, Parkinson,
multiple Sklerose, Epilepsie und Polyneuropathien erstellt. Auch durch den
Schwindel – der auch immer Schwindel beim Lernen erzeugt – schlug ich mich
durch, genauso wie durch verschiedene Tremorformen oder die Meningeosis neplastica
und sonstige eher exotische Dinge. Ich glaube, ich habe mich fachlich viel
weiter entwickelt in der Zeit und je mehr ich die Dinge verstehe, desto mehr
fasziniert mich dieses Fach. Auch am Fallbuch habe ich mit der Zeit wirklich
Gefallen gefunden.
Auch wenn das mit den mündlichen Prüfungen sehr ätzend war und ich
durch die erste Prüfung des Medizinstudiums gefallen bin – im Nachhinein hat es
mich doch weiter gebracht – nicht nur fachlich. Der Neuro – Oberdoc hat mich
gelehrt, dass vom Versagen nicht die Welt untergeht, dass ich als Person nicht
weniger wert bin. Und vielleicht hilft es mir auch ein wenig fürs mündliche Examen.
Nachdem ich mit 18 Jahren in der Abizeit noch viel zu sehr unter dem
Einfluss meiner Mutter stand und mich gegen ihre Ideen überhaupt nicht wehren
konnte, war dieses Medizinstudium keine eigene Entscheidung. Lange habe ich damit
sehr gehadert und es so gesehen, dass ich die nächsten sechs Jahre wohl auch
eher mit dem Schreibtisch verheiratet sein werde. Aber jetzt, wo ich mir meine
eigene Nische gesucht und meinen eigenen beruflichen Lebensentwurf gebastelt
habe, kann ich mich auch auf die Faszination der Medizin einlassen und meine
Tage mit der Neuro verbringen ohne das unter einem Zwang tun zu müssen.
Die psychische Situation beruhigte sich zwischenzeitlich etwas – was
für mich ziemlich entspannend war. Mit dem Seelsorger traf ich mich ein Mal in
der Woche in der Kapelle und wenn sonst etwas war, konnte ich tagsüber immer
den Neuro – Oberdoc anrufen und er hat sich bemüht, für mich eine Ecke Zeit zu
finden. Das war eine ganz andere Form von Lebensqualität – kein Hangeln mehr
von Termin zu Termin und dazwischen irgendwie überleben, weil der Kopf nach
spätestens vier Tagen wieder im Chaos ist und man die verbleibende Zeit bis zum
Termin irgendwie überbrücken muss, ohne einzuknicken.
Mit dem Seelsorger bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen. Durch
seine gestalttherapeutischen Elemente – was ich immer als „Stühlerücken“
bezeichnet habe - ist mir vieles klar geworden. Es ist nicht nur so, dass sich
einige Einstellungen geändert haben, ich die Situation jetzt vielleicht hin und
wieder auch mit etwas Abstand betrachten und dadurch anders bewerten kann. Es
ist auch so, dass ich mich nicht mehr so sehr verurteile für das, was passiert
ist und es mir nicht mehr so peinlich ist. Über die Zeit hat er mir klar
gemacht, dass ich die letzten Jahre sehr viel geleistet habe, mich aus vielen
Abhängigkeiten gelöst habe, mutig neue Wege beschritten habe – häufig trotz der
Tatsache, dass mir klar war, dass mich keiner halten kann, wenn ich falle. Dass
ich heute trotz allem mit einem fast fertigen Studium da stehe, dass ich einen
Weg vor mir sehe, der der meine ist – das ist nicht selbstverständlich. (Auch
wenn meine Familie ihren Weg schon wieder in den meinen integrieren möchte. Einerseits ist grundsätzlich alles falsch was ich mache, andererseits zieht man mir aber immer hinterher, was hin und wieder den Verdacht aufkeimen lässt, dass man eventuell nur etwas neidisch ist auf etwas, das man dem angepassten, stillen Mauerblümchen nicht unbedingt zugetraut hätte...)
Obwohl der Seelsorger hin und wieder viel über den Glauben geredet hat
und ich damit nicht viel anfangen konnte, weil ich nie am Religionsunterricht
hatte teilnehmen dürfen, geschweige denn, dass ich eine Kirche von innen
gesehen habe, hat es mich doch irgendwie fasziniert. Ich meine sogar
nachvollziehen zu können, dass man im Glauben einen Halt finden kann.
Glauben sei eigentlich etwas für mich, hatte er mal gesagt. Es sind
eigentlich immer dieselben großen Fragen, die die Menschen leiten. Manche mögen
darüber nie nachdenken, andere denken darüber nach und verzweifeln, weil sie
keine Antwort finden und wieder andere finden ihre Antworten und ihren Halt in
der Unsicherheit, die diese Fragen erzeugt, im Glauben.
Ich weiß ja nicht, wo ich da anfangen soll, aber ehrlich gesagt
beschäftigt es mich und irgendwie würde ich doch gern mal tiefer
hineinschnuppern und herausfinden, ob das etwas für mich ist.
Es gab Wochen, in denen ich sicher war. „Sie versprechen mir, dass Sie
anrufen, wenn etwas ist…“, forderte der Seelsorger irgendwann. Und obwohl mich
so etwas immer stresst, war ich auch dankbar. „Mondkind, wir können hier
ehrlich über alles reden. Auch über die dunklen Ecken, in denen ich Dich da manchmal
verliere. Denn manchmal nimmt allein das Reden darüber, den Schrecken…“,
erklärte der Neuro – Oberdoc ungefähr zur selben Zeit.
Der Spagat zwischen einem Menschen, der mir so viel bedeutet und einem
Chef, der der Oberarzt auch ist, ist nicht immer einfach. „Manchmal frage ich
mich schon, was wir hier machen“, sagte ich mal, „ich meine… - Sie
sind mein Chef… - aber irgendwie funktioniert es ja.“ „Genau, es funktioniert
sogar sehr gut“, hatte er entgegnet und versichert, dass das so für ihn in
Ordnung ist.
Der Neuro - Oberarzt hat es in beeindruckender Weise geschafft, mich als Menschen mit
allen Eigenschaften zu akzeptieren, mich zu fördern und zu fordern und gleichzeitig
ein Verbündeter und ein „Ersatzpapa“ zu sein, wie er das irgendwann selbst mal
formulierte.
Zwischen fachliche Erörterungen streute er manchmal einfach so die
Frage: „Wie klappt es gerade mit den Medikamenten?“ oder „Wie schläfst Du
gerade?“, oder „Wie sieht es mit Suizidgedanken aus?“. Ich hatte immer Angst
ihn damit zu überfordern, oder dass es unpassend ist, aber ich war dankbar,
dass das irgendwen interessiert, wie es mir geht und empfand die Fragerei nicht
als unangebracht oder grenzüberschreitend. Es war schön, bei einem Menschen mal so komplett und uneingeschränkt
ehrlich sein zu können. Und zu erfahren, dass er mich trotzdem an dieser Klinik
haben möchte. Dass er auch alles versucht, um es mir so einfach wie möglich zu
machen. Dass ich noch einen eigenen Büroplatz bekommen habe, einen ruhigen
Raum, wenn ich ihn brauchte. Dass er manchmal Vorschläge hinsichtlich der
Medikation angebracht hat und dass er mir bezüglich der Bewerbung und dem
Startzeitpunkt den Rücken frei gehalten hat. Denn ich kann eben auch etwas –
fachlich meine ich jetzt. Und wenn man es schafft, diesem rebellierenden Teil
etwas Aufmerksamkeit zu widmen und es nicht verurteilt und einsperrt, damit es
noch rebellischer und unkontrollierbarer wird, dann klappt das auch.
Es mag alles ungewöhnlich sein, aber für uns ist es okay und richtig
so.
Ende des Jahres. Nachdem es mit dem Tag der offenen Tür und der Frage nach der Bewerbung nochmal turbulent war, hieß es Taschen packen. Traurigkeit. Aber auch Dankbarkeit.
Unfassbar viel Dankbarkeit. Ich neige manchmal dazu, das zu vergessen. Weil es
eben auch weh tut.
Und dennoch macht mir genau dieser Schmerz klar, dass es entgegen
vieler Zweifler für mich die richtige Entscheidung sein wird, dorthin zu gehen.
Vorläufig jedenfalls. Es redet ja keiner von „für immer.“ Ich möchte eine sehr
gute Neurologin werden. Und ich hoffe, dass ich auch das dort werden kann. Aber
der Oberarzt berichtete, dass die Klinik auch schon viele gute Fachärzte hervor
gebracht habe – und ein bisschen liegt es auch immer an einem selbst. Die
Ausbildung präsentiert einem keiner auf dem Silbertablett. Da muss man sich
schon ein bisschen selbst drum kümmern.
Die beiden Hauptakteure dieses Jahr und die beiden Menschen ohne die
vieles anders gekommen wäre, musste ich jetzt erstmal hinter mir lassen. Wobei
ich mir aktuell überlege, ob ich nicht nochmal versuche den Seelsorger
anzurufen, oder ihm zu schreiben. Irgendwie hat mich sein schneller Abgang aus
der Neuro beunruhigt und ich würde gern wissen, wie es ihm geht – einfach, weil
er für mich ein wichtiger Mensch geworden ist. Aber ich weiß nicht, ob es
unpassend ist.
Jedenfalls werde ich daran sicher noch ein paar Wochen zu knacken
haben, es wird noch eine Weile weh tun, aber sie haben mich auch sehr viel weiter
gebracht auf meinem Weg, sind maßgeblich für die Perspektive verantwortlich,
die ich heute habe. Ich hoffe, ich habe meine Dankbarkeit dafür ausreichend zum
Ausdruck gebracht.
Ich glaube, seitdem ich mich aus dem Elternhaus befreit habe, für mich
und meinen Weg, meine Träume und Ziele gekämpft habe, ist vieles turbulenter
geworden. In meinem Elternhaus war alles ein Einheitsbrei. Solange, wie ich
nach der Pfeife meiner Eltern tanze, konnte ich auch Unterstützung erwarten –
verließ ich diese Pfade, war es damit vorbei.
Für den eigenen Weg kämpfen, bedeutete gleichzeitig entweder keine
Unterstützung zu haben oder sich welche zu suchen. Und auch wenn man die
gefunden hat, heißt das nicht, dass es leicht wird, weil es mir schwer fällt zu
vertrauen, dass Menschen bleiben.
Auch wenn dieses Jahr so seine Tiefs hatte, wenn viel Zeit dem Examen
gewidmet werden musste und auch, wenn es dieses Jahr Wochen gab, in denen die
Suizidalität so sehr im Vordergrund stand, dass es streckenweise ein Hangeln
von Tag zu Tag war, dessen einziges Ziel das Überleben war, so gab es doch auch
wunderschöne Momente. Die manchmal genauso wehgetan haben, aber die eben auch
so wärmend und so erhebend waren, dass sie dieses Jahr wirklich zu einem der
Besten seit langer, langer Zeit gemacht haben.
Jetzt sitze ich heute hier. Ich kann es noch nicht so ganz glauben, zurück zu sein. Ein bisschen bin ich beeindruckt von den
letzten 12 Monaten. Und richte den Blick vorsichtig auf nächstes Jahr. Auch das
wird viele Weichen stellen.
Allerdings startet es erstmal ganz unspektakulär. Zunächst stehen 12
Wochen Chirurgie auf dem Plan. Da ich absolut nichts erwarte, wird es
vielleicht besser, als ich mir das denke. Es stresst mich ein bisschen, dass
ich möglichst keinen einzigen Tag fehlen darf – ob nun wegen Grippe oder
psychischer Entgleisung, ist dabei völlig unerheblich.
Ich werde schon versuchen ab Januar meine Scripte vorzubereiten und
mitzulernen – wie sehr das klappt, wird davon abhängen, wie ich in der
Chirurgie beansprucht werde. Aber spätestens nach diesen 12 Wochen startet
Lernzeit 2.0. Vielleicht wird mir ja auch ein halbwegs interessantes viertes
Fach zugelost. Es steckt auch viel Druck dahinter.
Auch eine spannende, weil folgenreiche Frage ist, wie es mit der
Therapie weiter geht. Der Neuro – Oberarzt sagte, dass ein Therapeutenwechsel
jetzt – auf den letzten Metern – schon bitter wäre und man für derartige
Veränderungen in der Examenszeit wenige Kapazitäten hat. Abgesehen davon, würde
ich mit einem neuen Therapeuten in den wenigen verbleibenden Monaten wohl kaum
warm werden. Da hat er Recht – einfordern kann ich es allerdings nicht. Seit
beinahe einem Jahr erklärt die Therapeutin, dass sie mich abgeben wird. Und
dennoch hoffe ich, dass wir den Weg bis zum Examen noch gemeinsam gehen.
Nach dem Examen steht die Klinik auf dem Programm. Für mich ist das im
Moment die Motivation bis dahin durchzuhalten und der Lichtblick, dass ich noch mal die Chance bekomme einige Dinge für
mich zu überdenken und zu bearbeiten, bevor ich ins Arbeitsleben starte und ein
ständiger Chaoskopf die Qualität der Arbeit nur behindert. Ich hoffe auch, dass
ich die Sache mit der Suizidalität dann besser im Griff habe und nicht
ausnahmslos jede Krise am Tiefpunkt damit endet. Und vor allen Dingen hoffe
ich, dass ich die Chance bekomme, den Plan durchzuziehen. Dass die Familie sich
nicht wieder irgendwelchen Mist einfallen lässt, dass die in der Klinik im
spannenden Moment noch wissen, dass der Psychiatrie - Oberarzt gesagt hat, dass
ich ihm einfach schreiben soll, wenn ich weiß, wann ich fertig bin und sie mich
dann nehmen. Denn auch dort neigt man ein wenig dazu zu denken: „Naja, die
packt doch alles irgendwie – was zum Geier will die eigentlich…?“
So gut wie jeder weiß, dass ich – wenn ich zurück komme an den Ort, an
dem ich mein PJ bisher absolviert habe – gegen Herbst auf der Matte stehe. Ein bisschen stresst es mich, denn ich
fürchte, dass auch das Vertrauen des Neuro – Oberarztes in mich empfindlich
gestört werden würde, wenn ich schon wieder durch eine mündliche Prüfung falle und dann nicht zum geplanten Zeitpunkt da wäre.
Es sollte also klappen.
Und dann bin ich gespannt, wie ich
das Wohnproblem lösen werde. Und ob meine Schwester eventuell vor mir da ist, da sie dort ja
jetzt auch wieder arbeiten möchte. Was ehrlich gesagt die Sache mit der Klinik
wieder ein bisschen auf wackelige Füße stellen würde. Denn wie soll ich
erklären, dass meine Schwester drei Monate früher dort ist und in diesem
kleinen Dorf sicher gesehen und zunächst auch mit mir verwechselt wird? Und wer
weiß, ob sie dann nicht Klartext redet und die Neuros schneller alle wissen,
dass ich in der Psychiatrie abhänge, als ich mich umschauen kann. Aktuell hält meine Schwester sich allerdings sehr bedeckt. Ich gehe davon aus, dass sie etwas vom Chef gehört hat - jedenfalls habe ich in den Tagen vor Weihnachten laufend Gejammer gehört, dass sie nichts gehört hat, was jetzt verebbt ist. Meine Fragen diesbezüglich irgnoriert sie - was ich vor dem Hintergrund, dass sie meine Connections genutzt hat, um in meine kleine Welt dort unten einzudringen, schon wenig sozial finde. Am Ende werde ich es vielleicht erst heraus finden, wenn sie mich im Sommer vor vollendete Tatsachen stellt. Und bis dahin kann ich nur sagen: "I hope, that it was not only just a dream..."Und damit jetzt keine Missverständnisse entstehen: Ich wünsche mir, dass sie glücklich wird. Nur hat man als Zwilling glaube ich nach über 20 Jahren mal das Recht, ein eigenes Umfeld zu haben - insbesondere, wenn man so lange für eine eigene Zukunft kämpfen musste.
Ich hoffe, dass das nächste Jahr für mich auch gut wird. Dass alles so
klappt, wie ich mir das erhoffe. Ich in 12 Monaten vielleicht mal in ruhigeren
Fahrwassern angekommen bin. Weiß, wo ich die nächsten Jahre arbeiten und wohnen
werde. Und ich hoffe, dass der Neuro – Oberdoc Recht hat und ich zur Ruhe komme
und psychisch stabiler werde. Kein Hangeln mehr von Punkt zu Punkt. Sondern einfach
leben.
 |
| In der Hoffnung, dass dieses Bild nicht ein Kapitel für immer schließt... |
Mondkind















Kommentare
Kommentar veröffentlichen